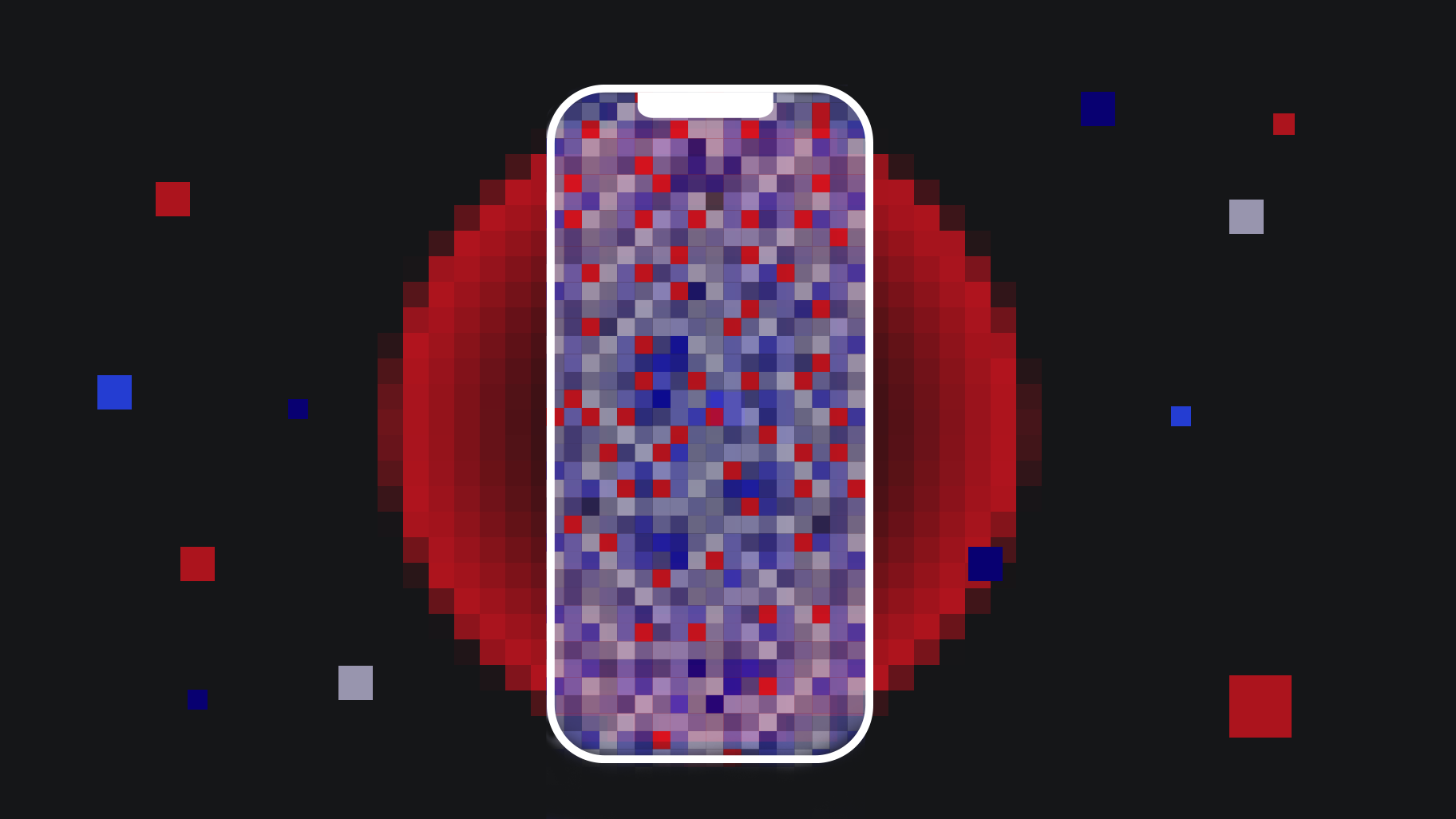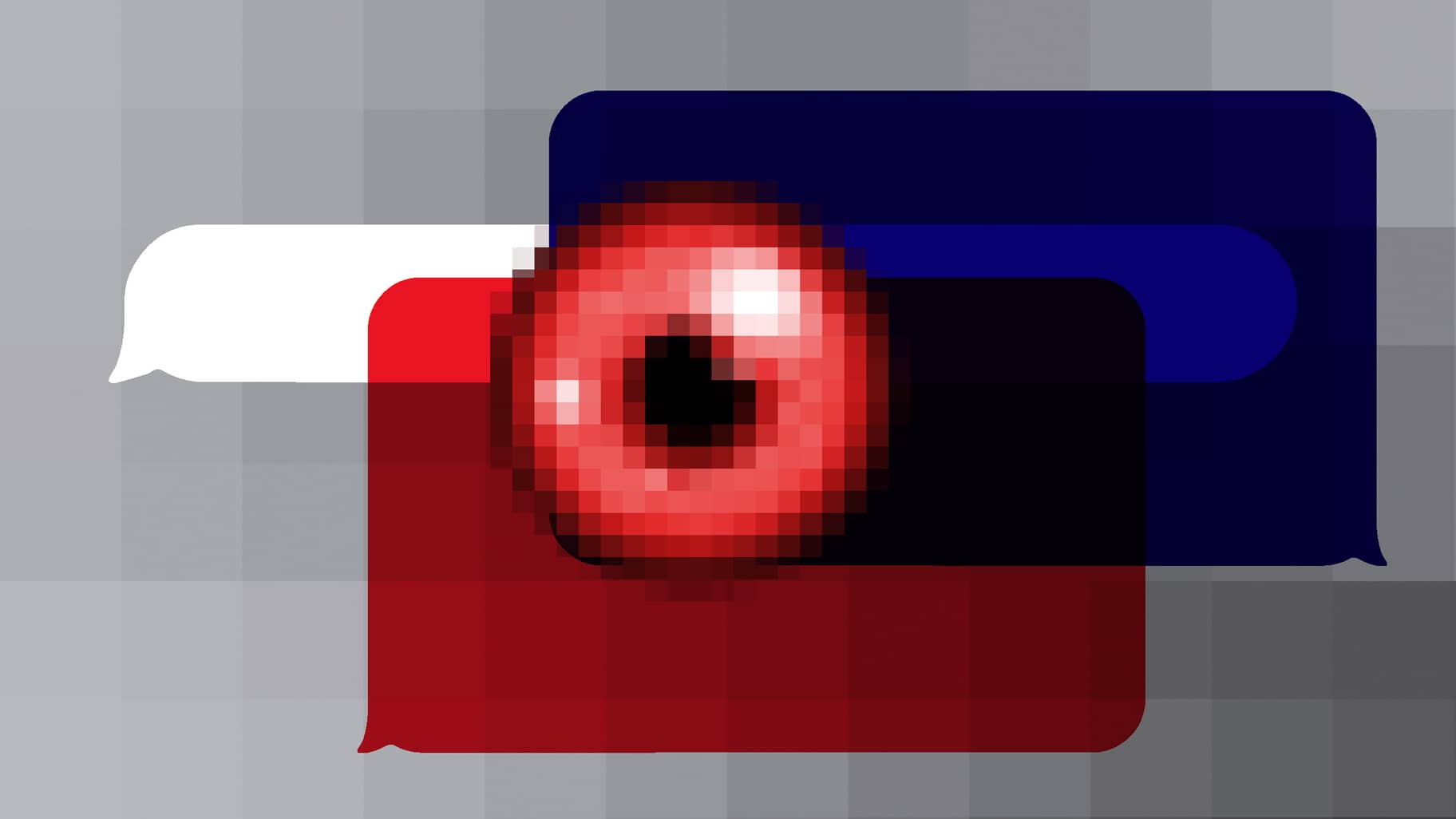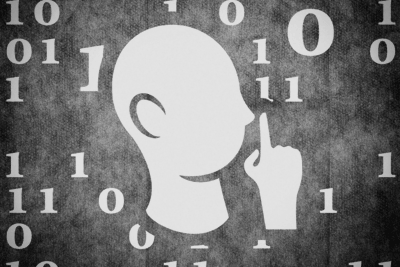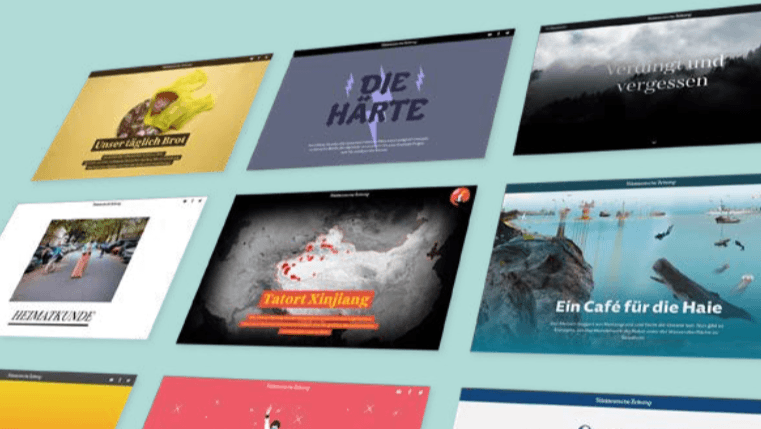SZ: Dubai ist bekannt für Palmeninseln und spektakuläre Bauten. Das Emirat wirkt weltoffen, zieht Influencer und Stars an. In Wahrheit ist es ein straff geführter Staat, die Gefängnisse sind voll, es gibt Berichte von Folter. Wie passt das zusammen?
Cinzia Bianco: Das Modell der Emirate ist sehr eigen. Was die Wirtschaft und den konsumorientierten Lifestyle angeht, sind sie nahe beim Westen. Aber was die politische Sphäre anbelangt, sind die Emirate weit näher bei einem autoritären System wie dem Chinas. Nur wer genauer hinschaut, merkt: Selbst grundlegendste politische und bürgerliche Freiheiten gibt es nicht.
Was bedeutet das konkret?
Wir müssen von einer absoluten Monarchie sprechen, einem voll autoritären System. Der Föderative Nationalrat, eine Art Parlament, wird zwar gewählt – doch die Kammer hat rein beratende Funktion, und längst nicht alle Bürger besitzen das Wahlrecht. Ein zweiter Punkt ist das Rechtssystem: Die Justiz ist stark von der Politik abhängig, und obwohl es Fortschritte hin zu mehr Liberalität gibt, findet man in den Gefängnissen jede Menge politische Gefangene. Ein dritter Punkt ist ein vollkommen neues Niveau der Überwachung.
Dass die Gesellschaft mit Spitzeln durchsetzt ist, ist in der arabischen Welt nichts Neues.
Aber jetzt verlagert sich das in den Cyberspace, wo die Überwachung ein ungekanntes Level erreicht. Überwachungssoftware macht die Spitzelarbeit für die Dienste sehr, sehr einfach.
Die moderne Software, die die Emirate dafür eingekauft haben, darf eigentlich nur zur Terrorabwehr benutzt werden.
Das Problem fängt bei dem Verständnis von Terrorismus an, das man zugrunde legt. In den Emiraten wird, wie auch in anderen Ländern am Golf, bereits Agitation gegen die Regierung in die Nähe von Terror gerückt. Wer Zwietracht in der Gesellschaft sät, wie die Machthaber das gerne formulieren, ist also Terrorist.
Ein Beispiel ist der Menschenrechtler Ahmed Mansur, der mehrmals verhaftet wurde und seit 2017 wieder in Haft ist, wegen „Bedrohung der öffentlichen Ordnung“. Ist er aus Sicht des Systems ein Terrorist?
Absolut! Er war der prominenteste einer sehr kleinen Gruppe, die 2011 mehr Bürgerrechte forderte. Dass sich die Ideen des sogenannten Arabischen Frühlings auch unter emiratischen Bürgern ausbreiteten, war für die Führung eine Horrorvorstellung. Sie wollte das so schnell wie möglich unterbinden.
Manche sagen: Durch ihre Überwachungstechnik gleichen die Emirate mittlerweile einer Art „Big Brother auf Steroiden“.
Ich bin weder IT-Spezialistin noch Doping-Ärztin. Aber ich würde sagen: Nicht weit von der Wahrheit entfernt.
Können Sie als Wissenschaftlerin in so einer Atmosphäre noch sicher arbeiten?
Ausländer, die als Troublemaker galten oder zu unbequeme Fragen gestellt haben, wurden früher des Landes verwiesen. 2018 aber war ein Wendepunkt. Mit Matthew Hedges wurde ein Doktorand aus Großbritannien festgenommen und über Monate festgehalten, sehr lange Zeit davon in totaler Isolation.
Hedges wurde laut den Projekt-Pegasus-Recherchen kurz vor seiner Verhaftung offenbar mit NSO-Überwachungstechnologie ins Visier genommen.
Es ist klar: Die Emirate mit ihrem zunehmend repressiven System sind ein sehr riskanter Ort, um Forschung zu betreiben.
Aber Investments in belanglose Kunst gewinnen doch keine Kriege.
Aber sie sichern die Bündnisse mit der westlichen Welt ab, das ist wichtig, etwa im Hinblick auf den Konflikt mit Iran - und sie hübschen das Image des Landes auf, das ja aus den genannten Gründen nicht das beste sein dürfte. Statt an Menschenrechtsverletzungen denken viele an spektakuläre Bauten, wenn von den Emiraten die Rede ist.