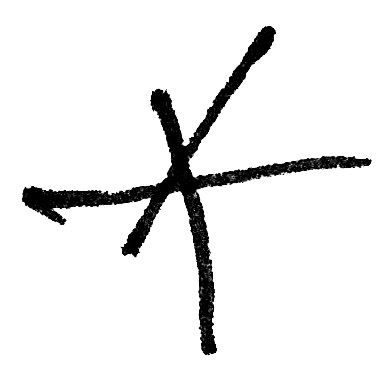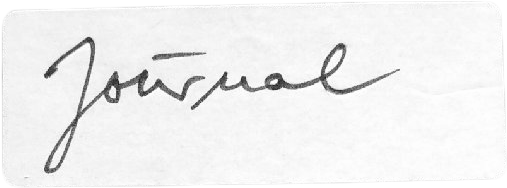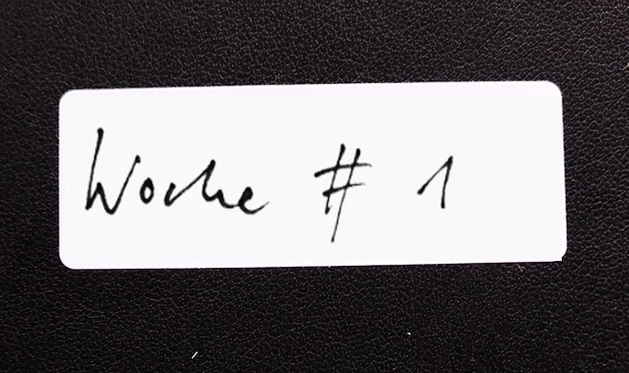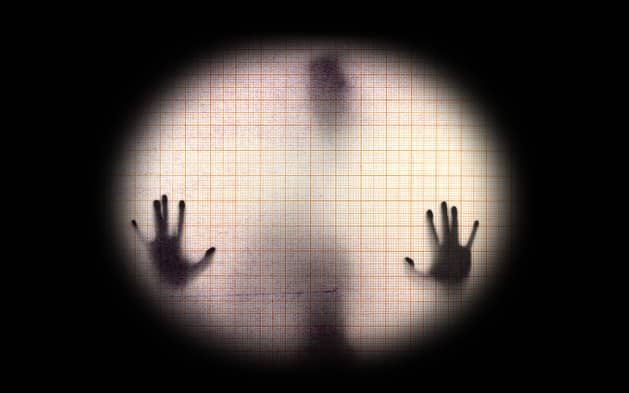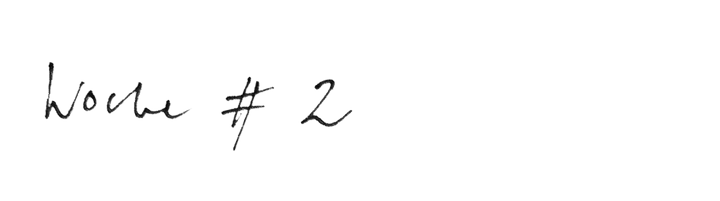

„Geschichten werden erzählt, um etwas zu vertreiben. Im harmlosesten, aber nicht unwichtigsten Fall: die Zeit. Sonst und schwerwiegender: die Furcht.“
- Hans Blumenberg -
Die Woche beginnt mit einer Lüge. Es mag ein Detail sein, das nicht stimmt, aber es ist eben doch eine Lüge. Ich schreibe dies nicht am Montag, dem dreißigsten. Montag war gestern. Ich schreibe mit einem Tag Verzögerung, das Schreiben hinkt dem erlebten Tag hinterher wie ein versteiftes Bein, das nachgezogen wird und einen synkopischen Rhythmus erzeugt. Gestern konnte ich nicht. Gestern war bloß stumme Lähmung. Verflogen alle wachsame Konzentration der ersten Wochen, all das hungrige Verstehenwollen der medizinischen, sozialen, politischen Facetten der neuen Wirklichkeit, all das eifrige Umstellen, Anpassen von Körpertechniken und sozialen Codes, all die rastlosen Gespräche, wer wie versorgt ist, wer allein, wen es zu begleiten gilt, all die geistigen Behelfsstrukturen, die die Strukturlosigkeit des Alltags retuschieren sollten - all das funktionierte nicht mehr.
Als ob es nichts mehr zu entdecken gäbe, als ob die steile Lernkurve, die den Anfang der Corona-Krise noch gekennzeichnet hatte, nun abbremste, flatten the curve, das war damit natürlich nicht gemeint, dass wir langsamer lernen würden oder gar nicht mehr. Aber so fühlte sich das an. Gestern. Als ob es in dieser Woche nicht mehr darauf ankäme, etwas zu analysieren, sondern als ob ich nun beginnen müsste, es wirklich zuzulassen: Das hier, das wird nun also unser soziales Leben sein, jeden Tag, über viele Wochen, vielleicht Monate, das also wird die Stille sein, die wir ertragen müssen, das also wird die räumliche Zone sein, das Viertel, die Nachbarschaft, in der wir uns aufhalten dürfen, das also ist, worauf wir verzichten müssen, nicht nur mal eben, als fürsorgliche Geste, sondern als anhaltende Praxis, das also, was uns belastet, die fehlenden Einnahmen, die wegbrechenden Aufträge, das wird sich potenzieren, der Verlust, der sich irgendwann nicht mehr ausgleichen lässt, Verlust, nicht nur an Erspartem, an Arbeitsplatz, sondern auch an geliebten Menschen, von denen wir nicht bedacht hatten, wie alt sie sind, oder von denen wir nicht wussten, was ihre Körper in sich trugen von früheren Krankheiten oder Verletzungen, das also werden unsere Nächte sein, schlaflos oder durchzogen von Träumen, in die das, was wir tagsüber zu denken nicht zulassen, verschoben wird, das also wird wahr sein, jeden Tag, den wir überbrücken, bis wir uns schließlich fragen: Wie lang und tief das, was überbrückt werden soll, eigentlich sein kann.
Vielleicht irritiert sie mich deswegen so, die Frage nach dem Danach. Nicht die Frage nach den Kriterien für eine Öffnung, Bedingungen, die erfüllt sein sollten, damit die Beschränkungen wieder aufgehoben werden - das ist nötig zu besprechen. Aber dieses: Wie soll es „danach“ werden? Wer werden wir „danach“ sein? Was wird „danach“ für immer verloren sein? Was werden wir „danach“ erst in seinem Wert verstanden haben? „Danach“, „danach“, „danach“. Ich bin so mit Epidemie im Jetzt befasst, in der Gegenwart, die sie formt, verformt, diktiert, die wir beobachten, begreifen, uns aneignen müssen. Es ist die Gegenwart, in der wir alle, jeden Tag, einzeln, aber auch miteinander, nach Spielräumen suchen müssen, nach temporary autonomous zones, wie der Schriftsteller und Philosoph Hakim Bey das genannt hatte, „temporär autonome Zonen“, soziale und kreative Praktiken, die für einen kurzen Augenblick etwas unterbrechen, die subjektive oder kollektive Autonomie anbieten, für eine begrenzte Zeit.
Es ist die Gegenwart, die mich umtreibt, jeden Tag, wie sie sich verwandeln lässt in etwas, das mir gehört, wie ich handlungsfähig, zugewandt, wach bleiben kann. Das Nachdenken über das „Danach“ ist nur ein Fluchthelfer der Phantasie.
Was werden wir „danach“ als Erstes tun, wenn es vorbei ist? Natürlich habe ich auch imaginäre Listen für das „Danach“: in eine überfüllte Bar gehen und wildfremde Frauen küssen; all die Orte besuchen, an denen Freunde eingeschlossen oder ausgeschlossen sind, Menschen, um die ich jetzt bange und von denen ich mich nicht verabschiedet habe, vor dieser Zeit, weil ich nicht wusste, dass ich es vielleicht bald müsste; in ein Konzert mit einem Orchester in größtmöglicher Besetzung, wo die Musiker*innen eng aneinander sitzen müssen. Irgendeine Bruckner-Symphonie vielleicht. Auch wenn, wie ich mich kenne, mir eher nach etwas Kammermusikalischem oder einer Passion sein wird.
Ich war durch einen unglücklichen Zufall im September 2001 in Downtown Manhattan. Ursprünglich hatte ich mich in New York ausruhen wollen von den Reisen in Kriegsgebiete. Einige Tage Downtown bei einer Freundin, das hatte ich mir erholsam vorgestellt - als alles zerbrach am Morgen des 11. September. Zehn furchtbare, traumatische Tage später gab der Dirigent Kurt Masur mit den New Yorker Philharmonikern in der Avery Fisher Hall ein Benefiz-Konzert, das ich nie vergessen werde. Das „Deutsche Requiem“ von Brahms. Wir hatten vier Karten ergattert, jeweils zwei Plätze in zwei Reihen hintereinander. Per Zufall hatten wir Freunde uns so aufgeteilt, dass ich und die andere Heulsuse (der einzige Mann unter uns) zusammensaßen und die anderen beiden durch unsere Erschütterung nicht abgelenkt wurden.
Ich vermute: Niemand in diesem Konzert damals glaubte, dies sei schon ein „Danach“, ganz gleich, was die Musik versprach, auf welchen Horizont seine Zeilen uns verweisen wollten, nichts war vorbei, ich vermute, niemand von uns war in einem „Danach“ angekommen. Aber es war der erste Moment, an dem sich trauern ließ. Daran muss ich denken, wenn jetzt alle vom „Danach“ sprechen, und mir das “Danach“ noch nicht wahrscheinlich scheint. Vielleicht ist das Reden über das „Danach“ nur der Versuch einer Abkürzung, als ließe sich die Trauer, zu der wir tausendfach Anlass haben werden, übergehen. Wir werden „Danach“ unsere wiedergewonnene Freiheit feiern, wir werden einen Wiederaufbau oder, besser, einen echten anderen Aufbruch organisieren, wir werden hoffentlich eine gerechtere Gesellschaft, ein solidarischeres Europa schaffen, wir werden internationale und lokale Strukturen festigen, all das ... aber wir werden das Trauern nicht auslassen können. Wir werden um die Toten trauern, die geliebten Menschen, die wir nicht besuchen, nicht begleiten durften, wir werden nachholen wollen, was schmerzlich untersagt oder unmöglich war, das Abschiednehmen.
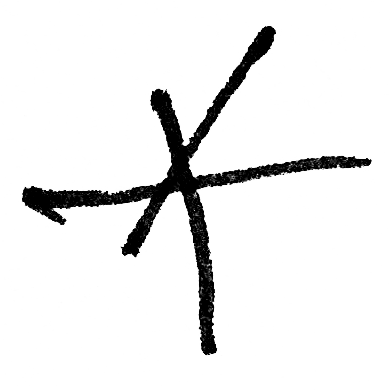
Der französische Soziologe Bruno Latour hat dieser Tage zu einer Übung angeregt, in der die Erfahrungen des gegenwärtigen Ausnahmezustands abgeklopft werden auf ihre Tauglichkeit für ein Später. Latour regt an, sich allein oder, wenn möglich, gemeinsam mit anderen unter anderem folgende Fragen zu stellen.
1. Welche der Aktivitäten, die im Augenblick verboten sind, möchten Sie anschließend auch nicht wieder zugelassen sehen?
2. Beschreiben Sie, warum Sie diese Tätigkeit für schädlich, überflüssig, gefährlich halten und warum ihr Verschwinden, ihr Verbot oder ihr Ersatz andere Tätigkeiten, die Ihnen wichtiger sind, erleichtern würden?
3. Welche Maßnahmen würden Sie empfehlen, um den Arbeiter*innen, Angestellten, Unternehmer*innen zu helfen, die nicht mehr das tun können, was Sie als Tätigkeiten abgeschafft haben?
Mich interessiert merkwürdigerweise keine einzige dieser Fragen. Mich treiben ganz andere um.
1. Welche der Aktivitäten, die Sie im Augenblick als existentiell erleben, welche der sozialen Praktiken, welche der solidarischen Gesten, welche der kreativen Formate, welche der ökonomischen Hilfsangebote sind unverzichtbar, spenden Trost, mildern die Not, verweisen auf eine Gemeinschaft, die es auch anschließend geben sollte?
2. Welche Berufe, die Sie im Augenblick als besonders notwendig und unverzichtbar erleben, sollten anschließend auch personell ausgebaut und finanziell gewürdigt werden? In welche soziale Infrastruktur, die Ihnen im Augenblick besonderen Schutz oder Fürsorge bietet, sollte anschließend massiv investiert werden? Welche Quellen, Verlage oder journalistische Angebote, die Ihnen im Augenblick besonders zuverlässig Informationen liefern oder Orientierung bieten, sollten besser unterstützt und bezahlt werden?
3. Wie ist es mit all den Tätigkeiten und Aufgaben, die im Augenblick als nicht „notwendig“ oder nicht „systemrelevant“ deklariert werden, die aussetzen müssen mit etwas, das ihnen wertvoll ist, die nicht als Logopädinnen oder Kellner, die nicht als Anlagenmechaniker oder als Kamerafrau, nicht als Koch oder als Schauspielerin arbeiten können, was ist mit all den Tätigkeiten und Aufgaben, die es doch auch braucht, die ausdifferenziert und arbeitsteilig erst das herstellen, was wir nutzen oder lieben ? Wie signalisieren wir ihnen unsere Wertschätzung, wie ersetzen wir ihre Verluste?
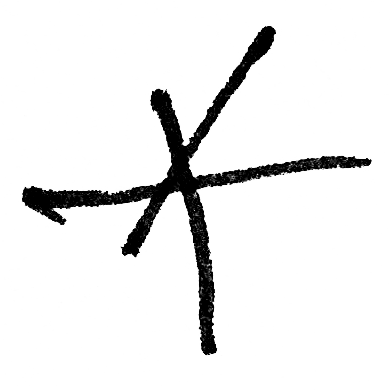
Am späten Vormittag wirbelten Schneeflocken vor dem Fenster. Die ersten des Jahres. Meine lateinamerikanische Freundin vertritt die These, dass Deutsche sich nur deshalb an Schnee erfreuen, weil sie von Kindheit an mit Schnee romantisierendem Liedgut und Gedichten indoktriniert wurden. Wem das fehlt, so ihre feste, jeden Winter wiederholte These, wer nicht von klein auf frostige Reime und flockige Lieder aufgesagt und gesungen hat, dem ist Schnee einfach nur ein kaltes, nasses, unangenehmes Etwas.
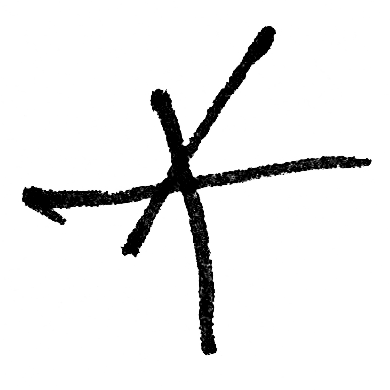
Und dann wurde an diesem Montag, dem 30. März 2020, der Rechtsstaat in Ungarn beendet. Warum Orbán das tut? Weil man ihn lässt. An einem Spielwarenladen in Kreuzberg hängt das Schild „Nu is zu“, das fällt mir dazu ein.



„Alle Notstandsmaßnahmen müssen auf das, was notwendig ist, begrenzt und streng verhältnismäßig sein. Sie dürfen nicht unbegrenzt dauern“.
- Ursula von der Leyen, Brüssel, am heutigen Tag -
Das ist alles. Das ist die Reaktion der EU-Kommissionspräsidentin auf Viktor Orbáns antidemokratische Notstandsgesetze. Das ist alles, was Ursula von der Leyen dazu anmerken wollte.
Was sie heute nicht gesagt, gehört aufgeschrieben.
Ursula von der Leyen hat nicht gesagt:
“Mein ganzes Leben war ich dankbar, deutsche Europäerin sein zu dürfen. Nicht allein durch die deutsche Geschichte und ihre Verbrechen gezeichnet und belastet zu sein, sondern auch in europäischen Bezügen denken und leben zu dürfen, erschien mir immer als unverdientes Geschenk.“
Ursula von der Leyen hat nicht gesagt:
„In dieser europäischen Gemeinschaft die nationalistischen, rassistischen, totalitären Dogmen zu überwinden und durch die Anerkennung unveräußerlicher Menschenrechte, durch Unabhängigkeit der Justiz, durch eine freie Presse, durch die Pluralität einer säkularen Demokratie zu ersetzen, das war das historische Versprechen Europas. In Bukarest oder Triest so willkommen zu sein wie in Marseille oder Antwerpen, an anderen Orten leben und arbeiten zu können, sich auch dort geschützt zu wissen, bei allem, was unvollkommen war und ist, bei allem, was noch inklusiver und gerechter werden muss, bei allem, was es noch an Vergemeinschaftung und an echter demokratischer Vertiefung braucht - diesem Europa wollte ich verpflichtet sein.“
Ursula von der Leyen hat nicht gesagt:
„Mir ist gleich, mit wessen Stimmen ich als Kommissionspräsidentin ins Amt gewählt wurde, mir ist gleich, in welchen Kontexten solch ein Stimmverhalten als Pfand missverstanden wird, als eine Gefälligkeit, die an anderer Stelle wieder eingelöst werden will, mir ist gleich, ob das die Erwartung war bei meiner Wahl, ich würde jedem Regierungschef, der mich gewählt hat, anschließend seinen autoritären Coup, seine Zerstörung der Wissenschafts- und Pressefreiheit, seine antisemitische, homo- und transfeindliche Menschenverachtung, seine diktatorischen Ambitionen durchgehen lassen. Das wird nicht geschehen. Das werde ich nicht akzeptieren in Europa.“
Ursula von der Leyen hat nicht gesagt:
„Wenn Europa nur noch ein leerer Signifikant ist …“, okay, na gut, das geht rhetorisch zu weit,
Ursula von der Leyen hat nicht gesagt:
„Wenn Europa nur noch ein Etikett ist, eine aufgeklebte Selbststilisierung, die Prinzipien als bindend und identitätsstiftend behauptet, sich aber windet und drückt, wenn diese gebrochen, ausgehöhlt und verhöhnt werden, dann ist das nicht mein Europa. Wenn Europa aus seinen Fehlern nicht lernt, wenn Europa nicht beides ernst meint: die Behauptung der wechselseitigen Hilfe und Solidarität wie die Behauptung der offenen, säkularen, inklusiven Demokratie, wenn wir einerseits einander fallenlassen und andererseits zulassen, wie Freiheits- und Bürgerrechte verstümmelt und ausgesetzt werden, dann ist das kein Europa, dann ist das keine Gemeinschaft.“
Vielleicht wird sie es später sagen. Vielleicht wird sie wortlos handeln. Vielleicht.
Ich weiß nicht, wie frühere Chronisten in ihren Tagebüchern, Journalen, Cahiers gezweifelt haben, wie ungeschützt sie schreiben dürften, wie viel Unverstandenes, Rohes zulässig wäre, wie frisch, wie eilig, wie irrtümlich, aber auch wie ungezügelt wütend sie sein dürften, wie unsicher sie waren, welche Ereignisse schon im Moment ihres Geschehens als unvergesslich und unverzeihlich galten. Das frage ich mich zumindest an diesem Tag, an dem ich den Zorn über mein geliebtes Europa nicht mehr einhegen mag. Die Scham erscheint mir im Traum wie ein vielköpfiges Ungeheuer: die ausbleibende Evakuierung der Lager auf den griechischen Inseln, die ausbleibende finanzielle Unterstützung der südlichen Staaten, in denen Menschen elendiglich sterben in überforderten Kliniken, Heimen, Lazaretten, die ausbleibende Vision eines Europas, das sich in und durch diese Krise endlich zu dem entwickelt, was es sein könnte: eine Gemeinschaft.
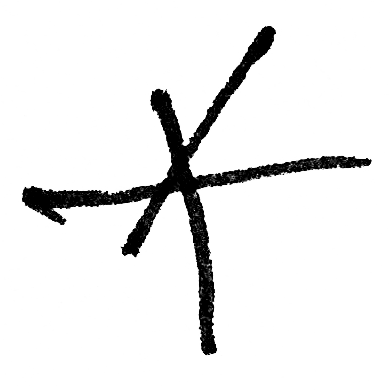
„Die guten Leute erkennt man daran,
Daß sie besser werden,
Wenn man sie erkennt. Die guten Leute
Laden ein, sie zu verbessern, denn
Wovon wird einer klüger? Indem er zuhört
Und indem man ihm etwas sagt.“
- Bertolt Brecht, Lied über die guten Leute -
Das ist das Versöhnliche an dieser Zeit: dass sie einen die guten Leute deutlicher erkennen lässt, dass manche zeigen, dass sie unter der Last dieser Tage nicht kleiner werden, nicht eiliger, nicht enger, sondern größer, ruhiger, offener. Sie tun das, was sie immer tun, sie sind die, die sie immer waren, unaufgeregt und pur. Neben all dem, was ängstigt und bedrängt, ist das nicht aufzuwiegen: die guten Leute zu sehen. Manche kannte man schon, manche lernt man jetzt erst kennen. Als ob die Krise die Konturen der Menschen schärfte und sie genauer zu erkennen wären.
Einer, der zu diesen guten Leuten gehört, ist ein Berliner Polizist, mit dem ich seit einigen Jahren befreundet bin, wir sind ein ungleiches Paar, nicht nur optisch, er spricht von sich als „Bulle“, was ich nicht leiden kann, und was dazu führt, dass ich ihn immer korrigiere und er es weiterhin verwendet, er ist Hertha-Fan, nicht nur so ein bisschen, sondern mitleiderregend ernsthaft, ich vermute, wir könnten nicht eine halbe Stunde lang die Lieblingsmusik des jeweils anderen ertragen, aber er ist einer von den guten Leuten. Wenn wir uns sehen, sprechen wir über unsere Stadt oder unsere Arbeit, weil wir uns vertrauen, testen wir oft gegenseitig unsere politischen Intuitionen, manchmal unsere privaten.
„Gleichzeitig aber
Verbessern sie den, der sie ansieht und den
Sie ansehen. Nicht indem sie einem helfen
Zu Futterplätzen oder Klarheit, sondern mehr noch dadurch
Daß wir wissen, diese leben und
Verändern die Welt, nützen sie uns.“
Und weil man sich in diesen Tagen einen Extraschuss gute Laune gönnen muss, treffe ich meinen Lieblingspolizisten zu einem langen Spaziergang, mittags, gleich nach seinem Schichtende, hole ich ihn ab. Er erscheint in Zivil, keine Uniform oder Dienstnummer, nur ein Johnny-Cash-Sticker am Revers der Jacke. Wir haben ausgemacht, immer schon, dass ich nie öffentlich mache, was wir besprechen, das gilt auch jetzt. Aber es war die beste Stunde des Tages und ich kann es nur allen empfehlen: jede Woche, mindestens einmal, sich etwas vorzunehmen, das einen wieder auffüllt, jede Woche mit jemandem oder für jemanden etwas Übermütiges, Herzerwärmendes, Albernes, Aufregendes, Beglückendes zu tun. Ganz gleich wie viel Kraft es kostet, es gibt Kraft.
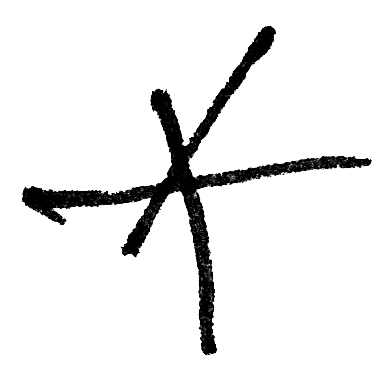

„Sofern wir im Plural existieren, und das heißt, sofern wir in dieser Welt leben, uns bewegen und handeln, hat nur das Sinn, worüber wir miteinander oder wohl auch mit uns selbst sprechen können, was im Sprechen einen Sinn ergibt.“
- Hannah Arendt, Vita Activa -
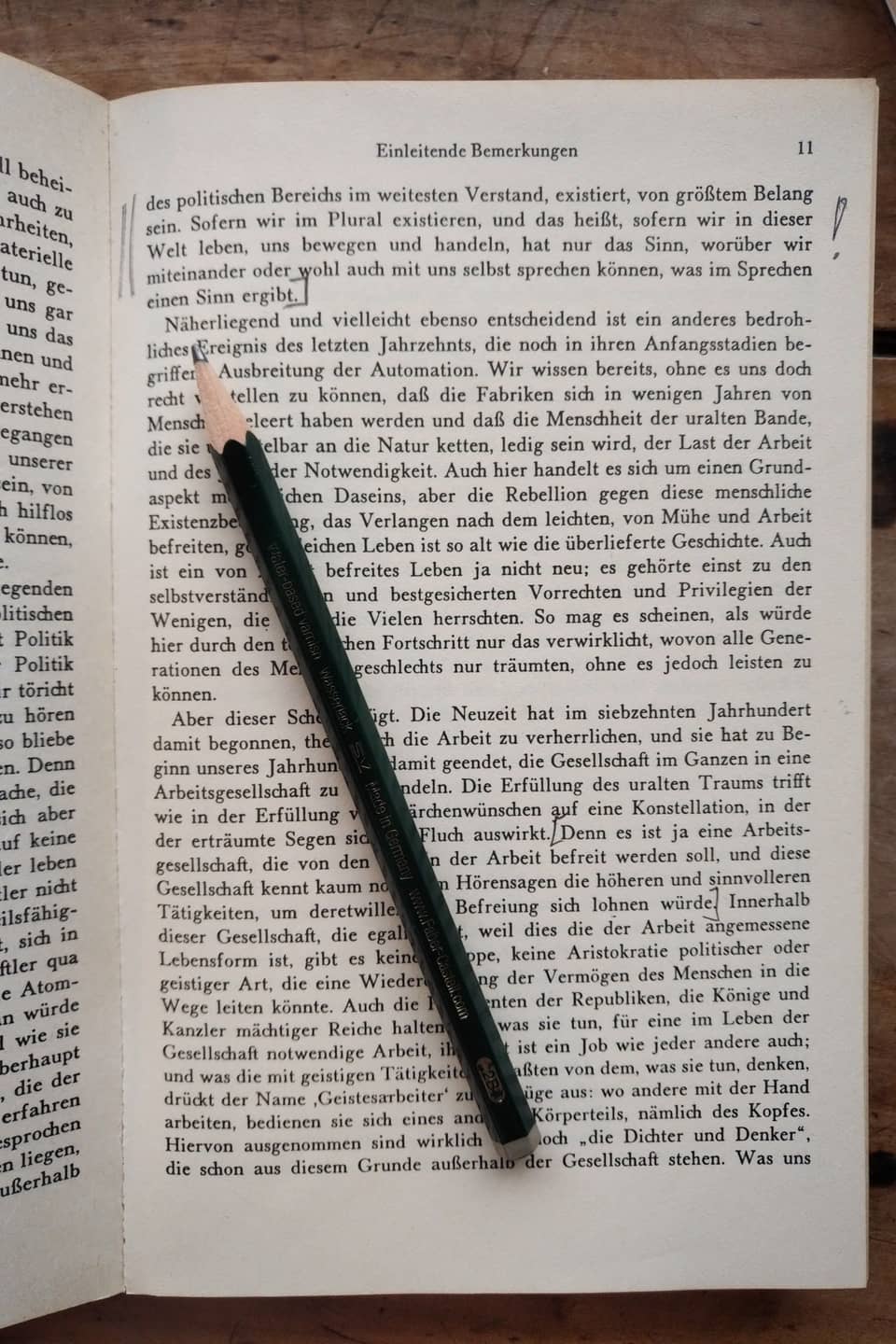
Was ergibt denn im Sprechen einen Sinn? Was ließ sich vor einem Monat, vor einer Woche, vorgestern noch sagen, was nicht mehr taugt, was seine Leichtigkeit, seine Unschuld verloren hat? Wie haben wir über alte Menschen gesprochen, als wären sie jemand anderes, als zählten sie nicht, als prallte an allen nicht alten, nicht kranken Menschen die Wirklichkeit ab, aber der Autofokus wird unscharf, wenn zur Selbstbetrachtung, zur Sorge um das Eigene alle die gezählt werden, die wir lieben, in unserer erweiterten Familie, unseren verzweigten Freundeskreisen, wenn wir nicht mehr im Singular, sondern im Plural denken, wenn all die mitgezählt werden, deren Musik, deren Texte, deren sportliches oder künstlerisches Talent uns durchs Leben begleitet haben. Wenn wir sie auf einmal als verwundbar, als sterblich denken, dann gehen uns manche der Worte nicht mehr so unbeschwert über die Lippen. Wenn wir Krankheit nicht mehr als Metapher, sondern als Krankheit denken, dann ergibt sich ein anderer Sinn.
Seit vergangener Woche schickt mir mein Freund Imran jeden Tag ein türkisches Wort zum Lernen. Das hatte ich mir gewünscht. Es gab keine Vorgaben, welche Wörter er mir beibringen sollte, ich hatte keine Hinweise gegeben, wofür ich sie brauchen wollte, in welchen Situationen, welchen Kontexten, mit welcher Absicht. Wörter zum Loben oder Wörter zum Verführen, Wörter, die den Hunger stillen oder Wörter, die zurechtweisen. Ich wollte einfach Wörter von meinem Freund, Wörter, die ich auflesen könnte, aufschreiben und sammeln. Sie würden vielleicht niemals einen ganzen Satz ergeben, niemals mir helfen, wenn ich mich verirrt habe und nach dem Weg fragen will, aber sie würden uns verbinden. Sie wären ein Vokabular der Nähe zwischen uns, die wir uns im Moment nicht nah sein können. Ich habe ihm das nicht so gesagt. Manches muss ich ihm nicht sagen. Das meiste eigentlich. Wir müssen ein neues Vokabular anlegen, mit den Menschen, die wir lieben, und vermutlich auch als Gesellschaft, die wir diese Krise miteinander überstehen wollen.
Mein erstes Wort war: bilmiş = Klugscheißer, das gefiel mir natürlich gut. Ich schrieb es mit der Hand in mein Notizbuch, das war einfacher, weil ich auf meiner Tastatur die richtigen Zeichen nicht immer zu setzen weiß. Und dann wollte ich jeden Tag ein weiteres Wort. Irgendwann schrieb Imran „Warum fragst Du das alles?“, und ich konnte antworten: weil ich ein bilmiş bin. Ich glaube, das gefiel ihm gut. Die ersten Tage musste ich noch betteln. Wo ist mein Wort?, und dann bekam ich sie eins nach dem anderen: azadi = Kurdisch: Freiheit, özgürlük - auf Türkisch. Azadi, das kannte ich schon, nörgelte ich, und prompt gab's am nächsten Tag etwas Anspruchsvolleres: kara sevda = wörtlich: schwarze Liebe, für verkannte oder unerwiderte Liebe. Für das nächste Wort brauchte ich eine Tonspur, um ganz sicher zu wissen, wie es sich ausspricht: cezaevi = Gefängnis, ab und an lassen sich nun doch Wortkombinationen bilden, fiel mir auf, zumal in der Türkei gern ab und an regierungskritische Klugscheißer ins Gefängnis verbannt werden. Als Nächstes günlük - Tagebuch, das Tagebuch eines Klugscheißers, bir bilmişin günlüğü. Das Wort für heute: hayat = das Leben.
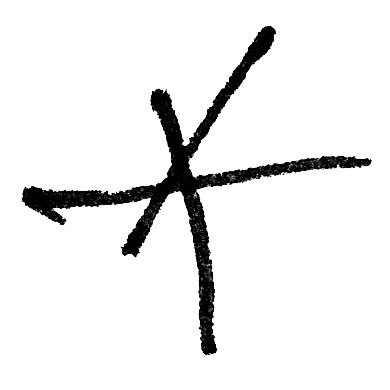
Es gibt Schwellen der Würdelosigkeit, oder: des individuellen Verfalls. Was immer wir uns einbilden, was uns oder unser Leben ausmachte, geben wir preis, wenn wir es müssen. Jeder, der nun einmal im Krankenhaus in einem dieser rücklings offenen Fummel liegen musste oder wer einmal in einer überfüllten Zelle eingesperrt war, weiß, wie antastbar die eigene Würde ist. Trotzdem gibt es diese Augenblicke der Dissidenz, winzige, widerständige Freuden, etwas tun zu können, das nicht passt, etwas beizubehalten von dem, was vorher zu einem gehörte, wer man einmal war, bevor man Patientin in der Klinik wurde, bevor man Häftling in einem Gefängnis wurde.
Die Corona-Krise verändert unsere Leben und unsere Gewohnheiten erst seit ein paar Wochen, das Home-Office-Homeschooling-Kontaktbeschränkungs-Disziplinierungs-Regime ist erst jung, aber schon jetzt ziehe ich bockig Grenzen ein, die ich auf gar keinen Fall unterschreiten will. Manche sind ernsthaft, manche eher amüsant. Aber selbst bei den lächerlichen Standards, die ich verteidige, als ginge es um etwas, geht es auch um etwas: einen individuellen Rest in einer kollektiven Erfahrung. „Happy Birthday“ zu singen, jedes Mal beim Händewaschen, ist mein Limit. Das Lied ist schon scheußlich genug, wenn es zu seltenen Anlässen intoniert wird. Permanent aber, jeden Tag, beim Händewaschen, wiederholt und wiederholt „Happy Birthday“ zu singen? Ausgeschlossen. Da kann ich gleich Tee aus Beuteln trinken. Erst habe ich mich mit „Viel Glück und viel Segen“ gewehrt, aber selbst das ist auf Dauer enervierend. Jetzt behelfe ich mir mit „Es waren zwei Königskinder“. Das passt motivisch und hat so viele Strophen, dass die Finger wund werden.
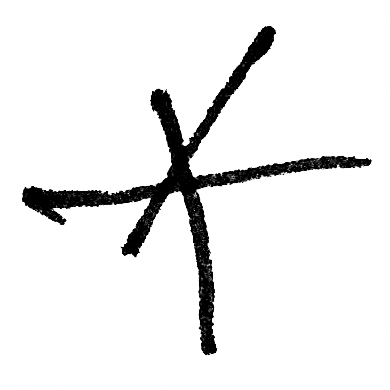

„Es wird immer leichter sein, in den Leiden anderer Menschen eher ein Unglück als eine Ungerechtigkeit zu sehen. Nur die Opfer teilen gelegentlich nicht diese Neigung.“
- Judith N. Shklar, Über Ungerechtigkeit -
Das ist vielfach der erste Reflex, beim Betrachten der Leiden der anderen: es von sich zu halten, je weiter weg, desto unbeteiligter lässt sich schauen. Denn in der Ferne, so lautet der Refrain der Verschonten, dort im Süden oder dort im unbestimmten Unten, lässt sich nichts ausrichten. Das sind andere Länder, andere Nöte, bedauerlich, das schon, tragisch auch, kaum auszuhalten die Bilder von den schutzlosen Geflüchteten im syrischen Idlib, was für ein Elend auch in den Kliniken in Madrid oder Bergamo, schrecklich, schrecklich, all dieses Unglück, in Lagos oder Rio de Janeiro, und nun auch in den Altenheimen hier bei uns.
„Wenn wir uns jedoch vor Augen halten, dass wir alle Opfer sein können, dann sollten wir uns entschließen, die Dinge noch mal zu betrachten und einen genaueren und fragenderen Blick auf die Ungerechtigkeit - und nicht nur die Gerechtigkeit - zu werfen.“
- Judith N. Shklar, Über Ungerechtigkeit -
So ungemütlich es ist, aber es ist nicht Zufall, nicht Schicksal, kein Unglück, was wir betrachten, als habe es mit uns nichts zu tun. Es hat mit uns zu tun. Es sind eben jene Ungleichheiten, die wir tolerieren, es sind jene Ungerechtigkeiten, die wir produzieren, hier bei uns, lokal, aber eben auch global, die wir akzeptieren, jedes Mal, wenn wir uns ernähren, telefonieren, anziehen, bei jedem Produkt, das durch zahllose Hände und Orte wandert bis es uns dient, es sind jene Lohngefälle, prekären Beschäftigungsverhältnisse, jene sozialen Unsicherheiten, die wir gern als bedauerlich titulieren, aber dann doch selbstverständlich hinnehmen.
Wenn wir in der Covid-19-Krise erleben, dass wir alle Opfer werden können, dass es alle treffen kann, wenn auch nicht alle gleich, dann sollten wir auch mehr unsere soziale, lokale, internationale Verbundenheit betrachten, nicht als zufällige Abstufungen des Glücks oder Unglücks, sondern als Ungerechtigkeiten, in die wir verwickelt, verwoben, verschuldet sind.
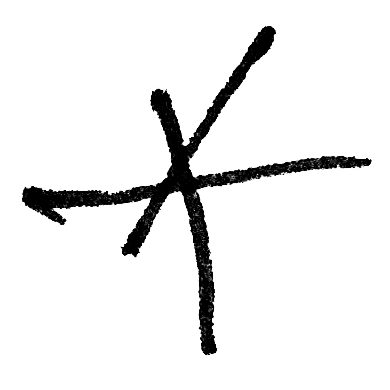

„Heute viele alte widerliche Papiere verbrannt.“
- Franz Kafka, Tagebücher 1912-1914. Eintrag am 11. März 1912 -
Vielleicht wäre das eine Aufgabe fürs Wochenende: „viele alte widerliche Papiere“ zu verbrennen, vielleicht wäre das eine Ablenkung, vielleicht würde das kurze Entlastung verschaffen, weil sich dabei einbilden ließe, man täte etwas Nützliches, man brächte etwas Ordnung, etwas Kontrolle in das endlose Offene dieser Situation. Meine guten Vorsätze, in dieser Zeit etwas zu sortieren oder zu reparieren, was mich das ganze Jahr über stört, in dieser Zeit endlich etwas zu trainieren, wofür mir normalerweise die Disziplin fehlt, Bauchmuskeln oder der perfekte Pizzateig, sie sind alle gescheitert. Ich habe gar nichts gelernt, außer einem türkischen Wort pro Tag. Immerhin. Aber vielleicht ist auch die Vorstellung der Kontrolle so kontraproduktiv wie die Sehnsucht nach schnellen Lösungen oder eindeutigen Antworten.
Es gibt eine Aufnahme eines legendären Konzerts der portugiesischen Pianistin Maria João Pires, die am Flügel sitzt, voller Saal bei einem Mittagskonzert in Amsterdam, sie hört die ersten Takte des Orchesters, das Mozarts „Klavierkonzert Nr. 20 in d-moll“ zu spielen beginnt - und realisiert voller Entsetzen, dass sie ein anderes Mozart-Klavierkonzert erwartet und einstudiert hat als dieses. Es gibt einen kleinen Videoclip, der diesen Moment des absoluten Schocks im Gesicht von João zeigt. Sie senkt erst den Kopf und schaut nach unten, fassungslos, dann beugt sie sich vor, stützt den Ellenbogen auf das Instrument, legt die Stirn in die Hand und schaut hilfesuchend zu Riccardo Chailly, der munter Takt um Takt dieses Konzerts dirigiert, für das sie keine Noten und keine Vorbereitung hatte (warum es für dieses Konzert mit Publikum keine Probe gab, erschließt sich nicht. Aber das war offensichtlich die Situation). Sie spricht leise zu Chailly und erklärt ihm, dass sie auf dieses Konzert nicht eingestellt ist. Dann wirft sie einen verzweifelten Blick über die Schulter zur ersten Geige, die Kamera zeigt nun Chailly, der durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist, voller Hingabe das Orchester durch die Musik leitet, während Pires kurz vor der Ohnmacht zu sein scheint. Es gibt einen kleinen Austausch: Die Pianistin versucht Chailly zu erklären, dass sie dieses Konzert wirklich nicht parat habe, aber der italienische Maestro will keine Not erkennen: Sie habe das Konzert doch letzte Saison noch gespielt, dann los. Es ist eine gespenstische und berückende Szene, wie hier jemand einer anderen Mut macht, wie er alle Verzagtheit, alle Lähmung sieht, und einfach mit Vertrauen, blindem Vertrauen beantwortet. Was folgt ist nur mit Verlust zu beschreiben. Man muss es sehen und vor allem hören. Pires sitzt vor ihrem Instrument und, nun gewiss, dass sie nicht abbrechen kann, sondern eben spielen muss, verändert sich ihr Gesicht: gesammelt, konzentriert, sie lässt sich ein auf die Musik, der Körper löst sich aus der Starre, sie hebt die rechte Hand für die ersten Takte des Klavierparts - und dann hört man sie spielen. So zart, so präzis, so traumwandlerisch sicher. Und, natürlich, hat sie alles parat, ist alles da, was sie braucht.
Es erinnert mich an diese Krise, in der wir erst so paralysiert sind, weil wir uns nicht vorbereitet glauben, weil wir etwas anderes erwartet, etwas anderes geübt, etwas anderes gehofft haben, und in der wir nicht wissen, wie wir diesen Augenblick überstehen sollen, in dem wir fürchten zu versagen, und wie es dann nur jemanden braucht wie Riccardo Chailly, der sich nicht Bange machen lässt, der einem zeigt, dass wir alles in uns haben, was es braucht, dass wir das Repertoire der gegenseitigen Hilfe abrufen können - und es uns durch diese Zeit bringen wird.
Wenn ich also mit diesem Journal wieder eine musikalische Empfehlung fürs Wochenende geben darf: Schauen Sie sich diese kleine Aufnahme mit Maria João Pires an. Und vielleicht hören Sie dann auch das ganze Konzert in Ruhe. Passen Sie aufeinander auf und bleiben Sie zu Hause!