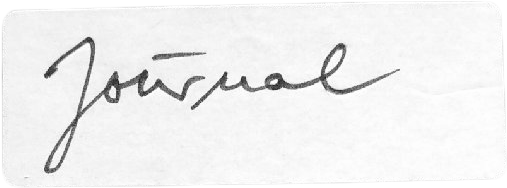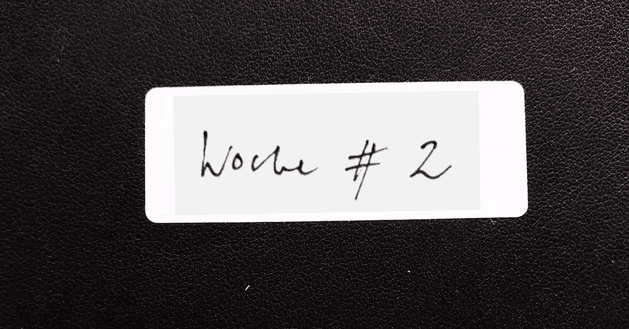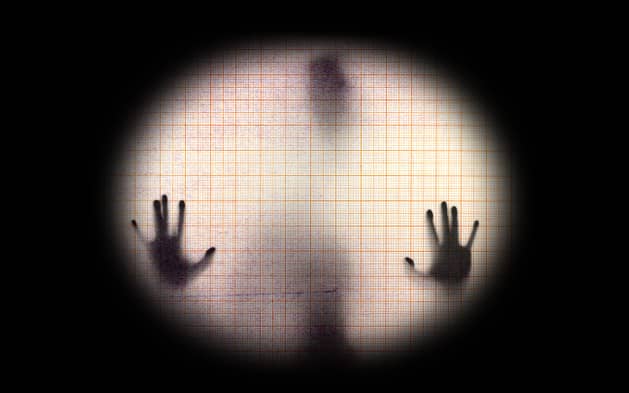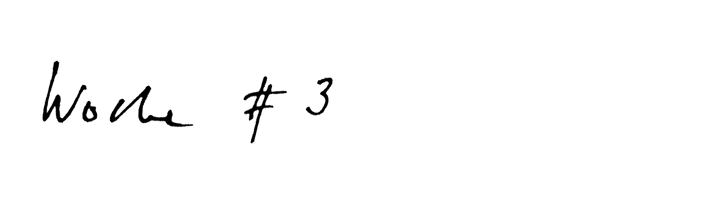

„Die Griechen, die offenbar viel für Anschauungshilfen übrig hatten, schufen den Begriff Stigma als Verweis auf körperliche Zeichen, die dazu bestimmt waren, etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den (...) Zeichenträger zu offenbaren. Die Zeichen wurden in den Körper geschnitten oder gebrannt und taten öffentlich kund, dass der Träger ein Sklave, ein Verbrecher oder ein Verräter war.“
- Erwing Goffman, Stigma -
Die Zeichen, die Menschen als Verbrecher oder Verräter markieren, die ganze Gruppen als gefährlich oder minderwertig aussondern, sie müssen nicht mehr in die Körper geschnitten oder gebrannt werden. Es reicht, sie wieder und wieder mit Vorurteilen und Ressentiments zu belegen, es reicht, wieder und wieder bestimmte Vokabeln, bestimmte Bilder, bestimmte Geschichten mit ihnen zu verkoppeln, in Filmen, in Videoclips, in (Kinder-)Büchern, oder auch in den sozialen Medien die ewigselben Lügen, die ewigselben Muster der Wahrnehmung so lange zu wiederholen, bis sie nicht mehr hinterfragt werden und einfach als vermeintlich „natürliche“, „echte“, „typische“ Eigenschaften unterstellt werden. Da gelten dann Individuen nicht mehr als Individuen, sondern nur noch als Angehörige einer Gruppe. Und alle Angehörigen dieser Gruppe werden mit so einem wummernden Grundrauschen als „dreckig" oder „kriminell“, als „krank“ oder „pervers“, als „gierig“ oder „mächtig“, als „gefährlich“ oder „rückständig“, als „faul“ oder „leistungsunwillig“, als „promisk“ oder „schlampig“, als „behindert“ oder „schwach“ unterlegt.
Das gab und gibt es immer. Und schon in normalen Zeiten müssen diese machtvollen Ressentiments kritisiert, die Assoziationsketten unterbrochen und durch andere Bilder, andere Begriffe, andere Geschichten ersetzt werden. Vor allem müssen die Praktiken der Diskriminierung aufgelöst werden. In Krisenzeiten wie jetzt, in denen alle den Kontrollverlust fürchten, in denen der Gegner unsichtbar und allgegenwärtig ist, da vermehren sich Vorurteile und Ressentiments: Sie werden gezüchtet und kanalisiert in bequeme Richtungen, sie nehmen sich Ärmere, Verletzbare, Marginalisierte, die es schon immer gab - und missachten sie einmal mehr. Als ob es sich in einer Krise weniger impotent fühlen ließe, wenn andere herabgestuft, entwürdigt und entrechtet werden. Als ob sich so die verlorene Souveränität wenigstens simulieren ließe, wenn Angehörige von Minderheiten oder auch nur die eigene Partnerin drangsaliert werden. Als ob die Epidemie gerade recht käme, um die eigene Menschenverachtung oder Misogynie besonders enthemmt ausleben zu dürfen. Mildernde Umstände werden schon vorab veranschlagt, in der Not ist das bisschen Gewalt, in der Epidemie ist das bisschen Ausgrenzung doch verständlich. Nicht wahr?
Man hätte einen Countdown für Sündenböcke beginnen und herunterzählen können, 10, 9, 8, 7, ... wann es beginnt, dass Schuldige gesucht und Minderheiten bestraft werden, ohne Anlass, ohne Grund, ohne Schutz. Man hätte in diesen Countdown auch gleich die alten Lügen mit anführen können, die nun wieder andere als todbringende Gefahr oder überflüssige Last konstruieren. 6, 5, 4, ... es sind unterschiedliche Staaten mit unterschiedlichen Opfern, aber das obszöne Spektakel der Hygiene-Phantasien oder utilitaristischen Kalkulationen ähnelt sich. 3, 2, 1, ... mal sind es alte Menschen, die Gebrechlichen, die mit „Vorerkrankungen“, deren Überlebenschancen in Zeiten knapper Ressourcen irgendwie verrechnet werden gegen jüngere, fittere Körper. Mal sind es gleich ganze Gegenden: engbebaute Viertel, nicht-informelle Ansiedlungen, die nun als nicht schützbar gelten, als wären tote Menschen in Port-au-Prince oder Lagos irgendwie hinnehmbarer als anderswo, als zählten sie nicht als vollwertige Menschen, als sei eine lehmige Hütte, ein Verschlag aus Wellblech und Plastik eine selbstverschuldete Leichtsinnigkeit.
Das Portal „Euractive“ berichtet dieser Tage von den Anfeindungen, denen sich Sinti und Roma in Rumänien, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei ausgesetzt sehen. In Bulgarien wurde in drei Städten, in denen mehr als 50.000 Angehörige der Sinti und Roma leben, ein „Kontrollsystem“ eingerichtet, das die ohnehin schlecht versorgten, sozial isolierten Siedlungen diskriminiert. Die rechtsnationalistische Partei VMRO hat demnach gefordert, alle Roma-Viertel unter Quarantäne zu stellen. In den sozialen Medien in der Slowakei und in Rumänien kursieren die klassischen Projektionen: Die Krankheit sei von den Sinti und Roma importiert (das ist ungefähr so intelligent wie die These, Covid-19 sei durch 5G-Netze ausgelöst), sie seien nicht angepasst - was sich vermutlich so auch über partymachende Skitouristen sagen ließe, aber da fehlen die alten Ressentiments, die das unterfüttern. Wohlsituierte Skitouristen oder feuchtfröhliche Karnevalisten haben Pech, marginalisierte Roma dagegen sind schuld. Das ist wie ein rassistischer Abzählreim, bei dem immer dieselben rausfliegen.
In Ungarn wurde vergangene Woche, passenderweise am „International Transgender Day“, vom Vize-Premierminister Semjén ein Gesetz ins Parlament eingebracht, das die Rechte von Trans*Personen nicht bloß infrage stellt, sondern nahezu aufhebt. Würde der Vorschlag bestätigt, gäbe es in Ungarn nur noch die Kategorie des „Geschlechts bei der Geburt“, definiert als „biologisches Geschlecht, das durch primäre Geschlechtsorgane und Chromosomen bestimmt würde. Alle offiziellen Identitätsdokumente müssten, so die Vorstellung, ausschließlich das Geschlecht bei der Geburt ausweisen und würden zudem alle Geschlechtsangleichungen, alle Namensänderungen verunmöglichen.
Das ist nicht einfach eine kleine, juristische Fingerübung, die eine unbedeutende Minderheit ein bisschen gängelt. Als ob es das gäbe: unbedeutende Minderheiten. Das ist eine existentielle Bedrohung für Menschen, deren Recht bestritten wird, zu sein wer sie sind. Diese Perfidie ging ein wenig unter in der allgemeinen Notstands-Gesetzgebungs-Raserei. Ich wünschte, es läge einfach nur an der allgemeinen Überforderung. Ich wünschte, es wäre nicht untergegangen, weil es als nebensächlich empfunden wurde. In einer Demokratie gibt es keine nebensächlichen Bürgerrechte, weil es keine nebensächlichen Bürger*innen gibt. Es gibt nicht hier die sozialen, ökonomischen Nöte der Arbeiterklasse und da die kulturellen, politischen Nöte der Marginalisierten. Sie gehören immer zusammen. Die einen sind nicht mehr wert, nicht dringlicher, nicht relevanter als die anderen. Mal abgesehen davon, dass sie sich gar nicht so auseinanderdividieren lassen.
In Lateinamerika ist das Misstrauen gegen die eigene Bevölkerung manchen politischen Eliten so eingeschrieben, dass ihnen die Repression und die Polizeigewalt im pandemischen Ausnahmezustand nicht einmal mehr wie eine Ausnahme erscheint, sondern nur die Fortsetzung derselben mit besser klingender Rechtfertigung. Die systematische Unterstellung, die eigenen Bürgerinnen oder Bürger verstünden keine rechtsstaatlichen, demokratischen Prinzipien, die noch jeden Coup oder Militärputsch zu legitimieren suchte, sie kursiert auch jetzt und gefährdet jene, die ohnehin schon verwundbar sind. In Argentinien erhalten Rentner*innen ihre Pension nicht einfach per Überweisung, sondern müssen persönlich bei einer Bank vorsprechen und sich das Geld in bar abholen - nur um mögliche Manipulationen oder Identitätsschwindeleien auszuschließen. Das ist nicht nur in Argentinien so. Rentner*innen müssen in vielen Ländern Lateinamerikas ihre mickrige Pension persönlich an den Banken abholen, weil die staatliche Verwaltung anscheinend nicht in der Lage ist, Todesregister und Rentenlisten zusammenzuführen. Weil nun unterstellt wird, es könne zu systematischen, massenhaften Betrügereien kommen (wenn Leute die Rente einer verstorbenen Person kassieren), müssen alte, gebrechliche Menschen sich zu den Banken schleppen, um zu beweisen, dass sie leben.
Das ist schon zu normalen Zeiten beschämend. Im Ausnahmezustand von Covid-19 ist es eine staatlich organisierte Gefährdung: da stehen nun diese Rentnerinnen und Rentner in langen, kraftraubenden Schlangen, der Abstand reicht hinten wie vorne nicht, manche mit Stock, manche mit Rollator - und warten auf das, was ihnen zusteht, aber abgeholt werden muss, als sei es ein Almosen. Wie viele dieser Menschen sich beim Warten infizieren, wird vermutlich nie nachvollzogen werden. Wahrscheinlich, weil es auch dafür getrennte Register gibt.
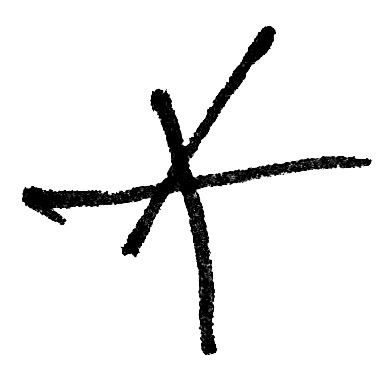
Zu den langlebigsten Illusionen über homosexuelle Paare gehört die Vorstellung, es gebe eine Aufteilung der Begabungen nach „männlich“ oder „weiblich“, eine heterosexuelle Binnenlogik sozusagen, die den Alltag des Zusammenlebens so gestaltet, dass traditionelle Geschlechterbilder darin gespiegelt werden. Während zwar eigentlich einem lesbischen Paar, weil es ja schließlich zwei Frauen sind, doppeltes Talent zum Kochen und Kinderhüten zugeschrieben werden müsste, splitten sich in dieser heterosexuellen Phantasie die Eigenschaften auf: Die eine soll hammermäßig geschickt alle Elektrogeräte reparieren und die andere filigran Schnittmuster nähen können. Wenn schon ein Paar nicht aus einem Mann und einer Frau gebildet wird, dann sollen, bitte, mindestens die klassischen Rollenmuster intakt bleiben. Alles andere wäre enorm verwirrend.
Diese Sehnsucht nach der heterosexuellen Norm in einer queeren Realität nimmt manchmal wirklich lustige Formen an: Wenn meine Freundin und ich Gäste haben, die uns nicht ganz so gut kennen, loben sie beim Essen immer, wirklich immer meine Freundin. Ganz gleich, ob ich Stunden in der Küche gestanden und Ottolenghi-Rezepte rauf und runter gekocht habe. Nun, um das Klischee ein für alle Mal zu korrigieren: Es gibt tatsächlich Paare, in denen beide gern kochen und leider keine die Waschmaschine aufschrauben und wieder heil zusammensetzen kann. Es soll übrigens auch schwule Paare geben, bei denen sich keiner für Modedesign oder Opern begeistert, #justsaying. Ich kenne allerdings auch kein einziges heterosexuelles Paar, das sich im wirklichen Leben die Gaben und Aufgaben so teilt, wie es die traditionellen Stereotype behaupten.
Jedenfalls hat die Aufforderung, sich selbst doch etwas Stoff zu nehmen und eigenhändig Schutzmasken zu nähen, in diesem Haushalt nicht die richtigen Adressaten gefunden. Meine Freundin hat aber in einem Laden in der Nachbarschaft etwas wirklich Passendes gefunden.

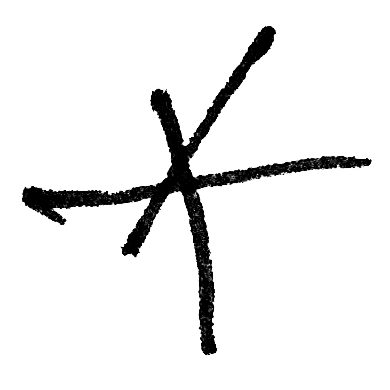

„Das Problem ist, ich will nicht, dass mir meine Traurigkeit genommen wird, ebenso wenig, wie ich will, dass mein Glück mir genommen wird. Sie gehören beide mir.“
- Ocean Vuong, Auf Erden waren wir kurz grandios -
Die Abende sind besser als die Morgen. Nachts bringt mich die blanke Erschöpfung in den Schlaf. Morgens früh, wenn alles noch still und die Luft noch kalt ist, morgens früh kommen die Fragen und schnüren einem den Atem ab wie ein eiserner Ring: Wie lange soll das so gehen? Wie lange werden wir das durchhalten? Wer ist Wir in diesem Satz? Was soll das Schreiben in Form einer Chronik, wenn doch diese Pandemie gerade das Asynchrone, Ungleichzeitige vorführt. Jedes Wir ist falsch. Jedes Wir klingt im besten Fall naiv, im schlimmsten Fall ignorant. Als ob es die sozialen, ökonomischen, politischen Ungleichheiten nicht gäbe. Wer soll das sein, dieses Wir, wenn die Lasten, die Privilegien, der Status so ungleich verteilt ist? Das ist nicht originell. Das ist auch sonst so. Es schreibt sich immer mit dieser Last. Aber mich verwirrt und beschämt es noch mehr als sonst. Was ich in Berlin schreibe, taugt nicht einmal als Eindruck von Berlin. Wie auch? Es ist nur ein Zeugnis aus dieser Stadt, von dieser Gegend, dieser schreibenden Person. Und es steht jeden Tag in brutalem Missverhältnis zu dem, was in New Orleans oder Bagdad oder nur in Wuppertal geschrieben würde. Früher ließ sich gegen die Scham des Privilegs anreisen. Konnte ich mit dem Wissen über die eigenen Verstrickungen in das Elend, das kein Elend, sondern Unrecht ist, schreiben. Das geht im Moment nicht.
Aber die Alternative ist noch fragwürdiger: Jede Möglichkeit des Verstehens, jede Möglichkeit der Zeugenschaft, jede Möglichkeit der Hinwendung zu anderen zu bestreiten, das wäre eine Absage an die Vorstellungskraft, eine Absage an die Empathie, eine Verweigerung der Universalität. Das wäre nichts als radikale Egozentrik. Es wäre bequem, weil es alle Anstrengung, mit und für andere zu denken, von vornherein für obsolet erklärt. Es wäre auch eine merkwürdige epistemische Selbstverstümmelung: zu glauben, die eigene Position verunmögliche das Nachdenken über die Position anderer, zu glauben, es ließen sich nicht gesellschaftliche Verhältnisse kritisieren, nur, weil sie einen bevorteilen - das wäre nun komplette geistige und ethische Insolvenz. Das kann's erst recht nicht sein.
Es lässt sich auch die eigene Perspektive, die eigene soziale Situation in Bezug setzen zu der anderer, immer wieder, es lässt sich auch nach einer Form suchen, in der die eigenen Privilegien so gedacht werden können, wie die Verletzungen und Ausgrenzungen. Viele von uns, das ist es jetzt, das Wir, viele von uns erleben doch beides. Und es lässt sich nicht denken, nicht handeln, nicht leben, ohne das allen Gemeinsame, die universale Humanität, zu suchen. Es braucht ein Wir, und sei es als utopischer Vorgriff, als schreibende Behauptung dessen, was herzustellen die Aufgabe ist, mit jedem verfluchten Text, aber vor allem durch politisches Handeln.
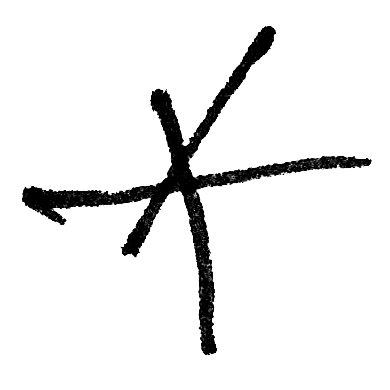
Abends wurde durch das Innenministerium vermeldet, dass sich Deutschland bereit erklärt, 50 Kinder aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen. Im Ernst?
50? Dafür hat man Wochen des Verhandelns und sich Windens gebraucht? Für 50 kranke oder unbegleitete Kinder unter 14 Jahren? Das ist alles? Es gibt Gesten, die sollen human oder solidarisch wirken - und offenbaren doch nichts als zynische Feigheit. 50? Hatte da ein Staatssekretär gerade 50. Geburtstag oder wie ist die Zahl zustande gekommen? Erklärt das jemand denen, die nicht mitdürfen? Erklärt das jemand Nr. 51 bis 1500. Und dann von Nr. 1501 bis ...
Im März noch hatte sich eine „Koalition der Willigen“ gebildet, was schon arg ist, denn da waren sehr viele Unwillige ringsum in Europa. Im März ging es noch um einen Anteil von 1500 Kindern, für die Deutschland - und außerdem Frankreich, Portugal, Finnland und Litauen - eine Aufnahme garantieren wollte. Aber nicht einmal die waren zuletzt noch willig, nicht einmal die 1500 durften es zuletzt sein, schon gar nicht, so war zu hören, wenn es ein deutscher „Alleingang“ wäre, wenn die anderen europäischen Staaten sich an ihre Zusagen nicht gebunden fühlten. Was ist denn das für eine Argumentation? Ob eine humanitäre Hilfe geboten ist, ergibt sich doch aus der Not, auf die sie reagiert - nicht aus der Frage, ob andere sie genauso leisten wollen. Muss neuerdings peinlich berührt sein, wer noch Menschen zu retten versucht, und nicht, wem sie gleichgültig sind?
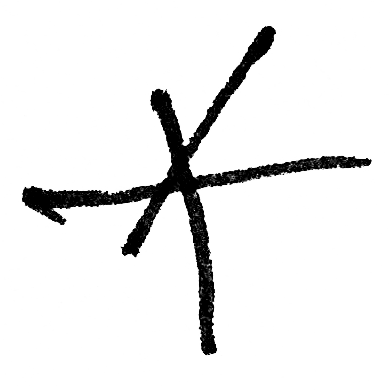
In meinem liebsten Märchen der Gebrüder Grimm, „Sechse kommen durch die ganze Welt“, gibt es den Mann, der allein durch das Pusten aus einem Nasenloch sieben Windmühlen antreiben kann. Der fällt mir jetzt wieder ein, wenn mir die Dauer der Einschränkungen und ihre Folgen Angst macht, wenn ich vorspulen möchte in der Zeit und mir wünsche, ich müsste dazu einfach nur aus einem Nasenloch pusten. Wenigstens vergesse ich nicht, dass das magisches Denken ist. Manche, die da als Experten durch die TV-Formate spuken, scheinen sich sagenhafte Prognosefähigkeiten anzudichten, sie pumpen sich so auf mit Eigenlob-Doping, um dann politische Maßnahmen zu fordern, als gäbe es das: Gewissheit. Fast beneidenswert. So zweifelsfrei zu sein.
Ich werde jeden Tag nur unsicherer. Meine Intuitionen werden wechselhafter: Ob sich diese Krise doch noch einhegen lässt, ob es die Kliniken doch recht gut auffangen können, ob es ausreichend politischen Willen geben wird, die ökonomischen Lasten nicht wieder denen aufzuerlegen, denen sie immer aufgebürdet werden, ob sich die Gesellschaft im Ausgang der Krise ernsthaft befragen wird, was anders werden, was transformiert oder reorganisiert werden muss. Oder ob sich diese globale Katastrophe immer weiter verschärft, ob sie uns alle auch beschädigt und versehrt, ob sie die Ungleichheiten nur vertieft, autoritäre Nationalismen befördert, ob jeder sich selbst nur der Nächste sein und bloß nichts verändern will danach. Das eine Szenario erscheint mir so denkbar wie das andere.
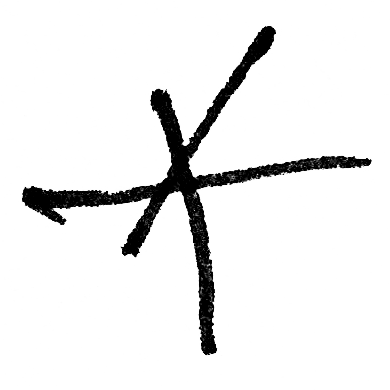

„Wenn ich keinen Stift habe,
denke ich an einen Stift“
- Liao Yiwu -
In der Küche steht eine Flasche Becks, die niemand anrühren darf. Sie ist reserviert für eine einzige Person. Die Flasche wartet hier auf sie. Damit niemand aus Versehen sich daran vergreift, heftet ein handbeschriebener Aufkleber daran. „Majeda's“. Majeda ist eine Freundin aus dem Gazastreifen, die ich von vielen Reisen dorthin kenne. Ich habe über die Jahre ihre Neffen aufwachsen sehen, habe mit ihr den Tod unserer Mütter betrauert. Und auch wenn ich sie seit langem nicht mehr besucht habe, schreiben wir uns noch. Jede Form der Gewalt oder des Fanatismus ist ihr so fern wie mir. Sonst wären wir nicht befreundet. Sonst könnte sie sich nicht mit dieser Hingabe für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzen.
Vor langer Zeit hat sie erzählt, wie das für sie war, als sie einmal hatte ausreisen dürfen, raus aus dem abgesperrten Gebiet, zu einem Festival in Europa, wie beglückend das gewesen sei, sich bewegen zu können, einfach so, wie ein freier Mensch, und wie sie sich damals auf einen Platz an einem Tisch eines Restaurants gesetzt und ein Bier bestellt und es getrunken habe. Öffentlich. Sodass alle es sehen konnten. Und wie nach Jahren unter der radikal-islamistischen Hamas im Gazastreifen (die Alkoholkonsum strikt untersagt) dieses nichtheimliche Bier ihr solch verdammte Freude bereitete, dass sie gleich noch eins bestellte. In Gaza mussten alle Spuren des Verbotenen beseitigt, Whiskey- oder Bierflaschen zerschlagen und entsorgt werden. Deswegen war das Schönste an Majedas öffentlichem Bier, dass sie nichts vertuschen musste, also bestellte sie eins nach dem anderen, und erklärte dem Kellner, nur ja nicht die ausgetrunkenen Gläser vor ihr auf dem Tisch abzuräumen.
Seit sie mir diese Geschichte erzählt hat, möchte ich mit Majeda ein Bier trinken, hier, in Berlin, aber dazu muss sie ausreisen dürfen. Ich habe das früher schon einmal geschrieben. In einer Kolumne. Vor vielen Jahren. Da war das Becks noch frisch. Das Haltbarkeitsdatum ist längst abgelaufen. Aber ich bringe es nicht übers Herz, die Flasche wegzuwerfen und durch eine neue zu ersetzen. Und es einfach aufgeben, das geht schon gar nicht.
Diese Tage schrieb mir Majeda und fragte, wie die Situation mit Corona hier sei, wie es sich lebe mit den Ausgangsbeschränkungen. Das war noch nicht mal ironisch gemeint. Was soll man da antworten? Sie schrieb noch: „Vergesst uns nicht.“ Das war letzte Woche. Heute ist Majedas Geburtstag, und ich habe sie gefragt, ob ich etwas von dem, was sie mir schreibt, aufnehmen darf in dieses Journal. Sie hat zugestimmt.
“Als die Epidemie ausbrach, habe ich mir alle geliebten Menschen und Freunde hier zu mir nach Gaza gewünscht“, schreibt sie, „weil es wie der sicherste Ort auf Erden schien. Ich hatte dieses Gefühl, sicher und beschützt zu sein, das ich so nicht mehr kannte, seit mein Vater gestorben ist“. Aber mit den ersten bestätigten Corona-Fällen auch in Gaza sei die Ruhe dahin. Wir sind voller Angst, schreibt Majeda, nicht vor dem Virus, sondern vor Erschöpfung.
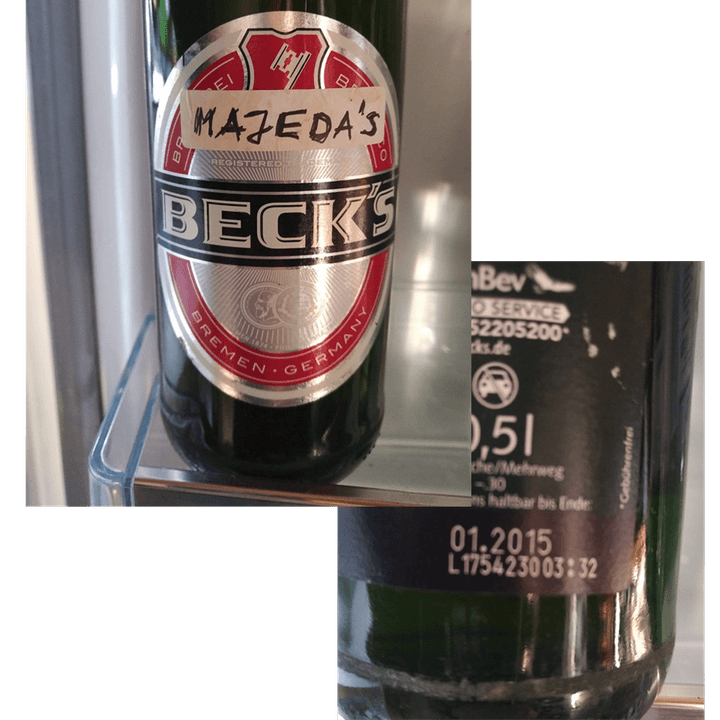
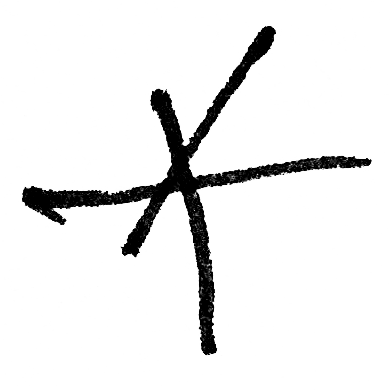
Die dpa meldet: Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht habe versichert, „die Aufnahme von 1 (ausgeschrieben: einem) Flüchtlingskind sei problemlos möglich“. Ein Kind? Ob die da sicher sind? Ob das nicht doch eine zu große Belastung wird? Puuh. So ein ganzes Flüchtlingskind, mit allem dran, Arme, Beine, Füße, das ist schon eine enorme Aufgabe für so ein ganzes Bundesland.
Meine Güte. Hört da eigentlich noch jemand hin? Eins. Ohne Probleme. Das könnte Realsatire sein, wenn es nicht so furchtbar wäre.

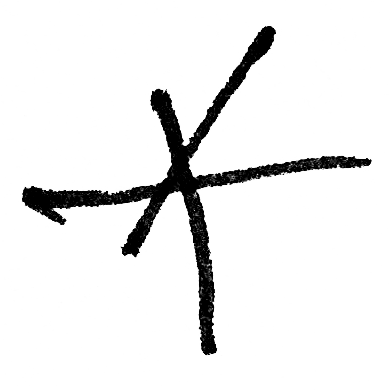
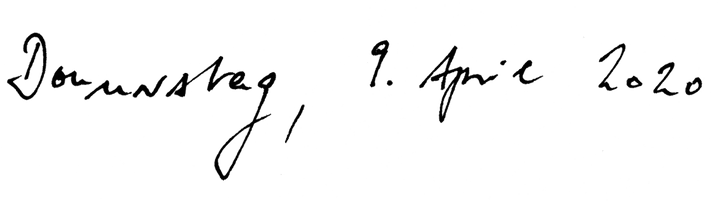
„No more apologies for a bleeding heart when the opposite is no heart at all. Danger of losing our humanity must be met with more humanity.“
- Toni Morrison, The War on Error -
Vor dem Altenheim in der Nachbarschaft steht eine kleine Familie, halb auf dem Bürgersteig, halb auf der Straße, damit der Blickwinkel nach oben in den dritten Stock nicht zu steil ist. Sonst könnten sie ihn nicht sehen, den Großvater, der sich auf die Fensterbank gestützt hat und herunterblickt, weil das alles ist, was ihm unter den geltenden Beschränkungen erlaubt ist. Von unten nun rufen sie hoch, das, was sie vielleicht auch sonst im Gespräch sagen oder fragen würden, das, was zugewandt und einfühlsam klänge, wenn sie einander gegenüber säßen und vielleicht die Hand auf die Hand des Anderen legen könnten, das, was ironisch oder verschmitzt, mit einem Lächeln, den anderen aufheitern könnte, das, was geflüstert ein Geheimnis bergen könnte, das, was sonst an Nähe entstünde, alles das, was sonst eben eine Begegnung ist, ein Gespräch, all das misslingt.
Es beginnt schon mit dem Stehen. Im Stehen lässt sich nicht frei sprechen. Im Stehen lässt sich etwas verkünden, im Stehen lässt sich streiten, aber nichts offenlegen, nichts teilen. Ich habe noch nie je von irgendeinem Menschen auf der Welt etwas im Stehen erfahren. Im Stehen lässt sich gerade mal nach dem Weg fragen, aber niemand erzählt etwas von sich, etwas Zartes, etwas Schmerzliches im Stehen. Dazu muss man gehen, spazieren mit- und nebeneinander, dazu muss man sitzen, bei einem Glas Tee oder etwas anderem, dazu muss man zeigen, dass nichts eilt, dass nichts wichtiger ist, dass es Zeit zum Zuhören, zum Kennenlernen, zur Begegnung gibt. Das Stehen ist immer das Vorläufige. Das wissen am besten die Alten, die nicht mehr lange stehen können. Aber auch niemand Jüngeres steht ewig auf dem Bürgersteig.
Dann ist da die Entfernung. Die Distanz verlangt nach Lautstärke. Allein: Laut lässt sich nicht richtig sprechen. Jeder Satz, jede Frage wirkt plump, wenn sie gebrüllt werden muss. Laut lohnen sich keine eleganten Worte. Laut lässt sich nichts Komplexes, nichts Ambivalentes ausdrücken. Selbst das Alltäglichste klingt gebrüllt auf einmal deplatziert. „Wie war das Mittagessen?“, was soll der arme Großvater darauf zurück brüllen? Weil alles öffentlich ist und die ganze Nachbarschaft mithört, fällt alles, was wirklich innig oder offenherzig oder auch nur albern wäre, sowieso raus. Derbe Witze lassen sich so wenig vom Bürgersteig aus zum Balkon brüllen wie sanfte Liebesworte.
Alle mühen sich, die Familie unten, die ja ihre Kinder eingepackt hat und hergekommen ist, um den Großvater wissen zu lassen, dass er nicht allein ist, und der Großvater oben, der da auf dem Fenstersims lehnt und der weiß, dass dies nun einmal die Verordnungen sind, die für alle gelten und die zum Schutz der medizinischen Grundversorgung der Gesellschaft erlassen wurden.
Auf dem Weg nach Haus male ich mir aus, was sie hätten einander sagen wollen. Auf dem Weg nach Haus mal ich mir aus, welchen Kummer sie sonst hätten miteinander teilen wollen oder welchen Tratsch, welche Kunststücke oder welche schlechten Manieren die Kinder hätten vorführen können. Auf dem Weg nach Haus male ich mir aus, ich hätte meine geliebte Großmutter, die vor langer Zeit gestorben ist, so besuchen müssen. Ich bin sicher, sie wäre dort oben am Fenster vor allem damit beschäftigt gewesen, sich die Traurigkeit nicht anmerken zu lassen, so wie ich, brüllend auf dem Bürgersteig, versucht hätte, mir meine nicht anmerken zu lassen. Zu lieben hieß und heißt immer auch, einander vor Schmerzen zu bewahren. Auf dem Weg nach Hause frage ich mich, ob das bei dieser Familie auch so war, ob sie auch deswegen so brüllten, um sich wechselseitig zu beschützen.
Es klang so vernünftig: „Nur Abstand ist Ausdruck von Fürsorge“, ja, für eine begrenzte Zeit, ja, aus Rücksichtnahme, aber trotzdem müssen wir als Gesellschaft fragen, wie lange das zumutbar ist, wenn wir als Personen dessen beraubt werden, was wir sind oder wer wir füreinander sein wollen. Der Deutsche Ethikrat spricht in seiner Ad-hoc-Empfehlung „Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise“ davon, dass auch der gebotene Schutz menschlichen Lebens nicht absolut gilt. „Ihm dürfen nicht alle anderen Freiheits- und Partizipationsrechte (...) bedingungslos nach- bzw. untergeordnet werden.“ Bislang ließen sich die Maßnahmen der Einschränkung als zeitlich begrenzte Maßnahmen rechtfertigen - eben um die Versorgung und Behandlung von Kranken (nicht nur denen, die an Covid-19 erkranken) durch das Gesundheitssystem zu garantieren. Es war politisch nachvollziehbar, in dieser Epidemie die ökonomischen, sozialen, psychischen Belastungen, die aus den Freiheitseinschränkungen folgen, für solidarisch geboten und für verantwortbar zu halten. Das wird sicherlich auch noch einige Wochen anhalten, bis der in den Modellen antizipierte höchste Wellenkamm erreicht ist und mit einem (mindestens vorübergehenden) Rückgang der Infektionen gerechnet werden kann.
Wenn nun aber über die Bedingungen eines „Renormalisierungsprozesses“, einer stufenweisen Öffnung des Shutdowns diskutiert wird, wenn schon von einzelnen Sektoren der Wirtschaft gesprochen wird, die ihre Produktion wieder sollen aufnehmen können, wenn schon darauf hingewiesen wird, dass Alte oder Menschen mit Vorerkrankungen auch dann noch geschützt werden müssen - so bleibt die Frage der Risikoabwägung und Verantwortungszuweisung heikel. Ob wirklich die Jungen, Fitten wieder alle ihre Freiheiten genießen dürfen, aber die älteren Menschen weiterhin isoliert bleiben müssen? Ob sich wirklich die Mündigkeit, die eigenen Risiken einschätzen und abwägen zu können, den einen zusprechen und den anderen absprechen lässt? Wenn wir über partielle oder stufenweise Renormalisierung sprechen, muss es eine Normalisierung für alle sein.

Die Hyper-Kommunikation der ersten Wochen, die besorgten Nachfragen reihum im Freundeskreis, in den Familien, per Telefon oder Video, das ununterbrochene Abklären, Aufmuntern, Erzählen, das die erste Zeit so ausgezeichnet hatte - es bricht doch merklich ab. Die engsten, geliebten Menschen werden immer stiller. Den Alltag im Ausnahmezustand kennen wir mittlerweile: wem alle Einnahmen wegbrechen, wer keine Aufträge mehr bekommt, wessen Eltern an der türkisch-syrischen Grenze in Quarantäne sind, wessen Vater gerade eine Herz-OP überstanden hat, wer die eigene Kneipe vermutlich nie wieder wird öffnen können, weil der Raum zu klein, die Plätze zu nah aneinander sind. Wir wissen von einander, wie bitter jeder auf seine Art existentiell getroffen wird, was sollen wir das einander noch erzählen, ein Klage-Dialog, wenn niemand Grund hat, dem anderen Mut zuzusprechen.
Und jetzt auch noch Ostern. Bei aller Freude über die innigen Tage, bei allem, was mich auch beeindruckt an dieser Zeit und wie wir sie hier zusammen erleben - es ist schon sehr zweisam. Also: wirklich zweisam. Man könnte auch sagen: irgendwie brutal spießig zweisam. Dauernd zuhause, kochend, mal spazierengehend, keine Bars, keine Clubs, keine Nächte mit Freunden, keine Konzerte, kein Theater, keine Partys hier oder woanders. Das war an sich nicht das Lebensmodell. Dazu gehörte immer die Freundesfamilie, dieser weitverzweigte Stamm an geliebten Menschen, mit denen wir gemeinsam denken und feiern, trauern und uns engagieren wollen. Das ist wirklich das Ärgste, jenseits all der ökonomischen oder politischen Sorgen, dieses Netz an Freund*innen zu vermissen, die sonst hier ein und aus gehen, mit denen sich sonst das Leben oder die politischen Zerwürfnisse diskutieren lassen, mit denen zusammen sich Ideen und Projekte entwickeln lassen, diese Freund*innen, die sich immer versammeln, wenn etwas über uns hereinbricht, wie Halle oder Hanau, und die wir nun alle einzeln oder zu zweit oder in unseren Familien hocken. So hatte ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Langsam sehne ich mich nach einer Massenorgie, nach einem endlos langen Rave, langsam sehne ich mich nach einer riesigen Demo, wo wir alle eng aneinander stehen und gehen, langsam sehne ich mich nach unserem früheren Leben.

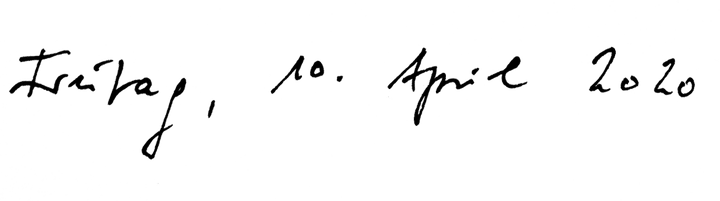
In der Nacht kam die Meldung, dass sich die Finanzminister der EU nun doch auf ein Rettungspaket geeinigt haben. Es werden verschiedene Instrumente eingesetzt: die europäische Investitionsbank soll angeschlagene Unternehmen mit Darlehen stützen (bis zu 200 Milliarden Euro), der Rettungsfonds ESM soll den besonders stark getroffenen Ländern zinsgünstige Kredite anbieten (bis zu 240 Milliarden Euro) und die Europäische Kommission will Hilfen bereitstellen, die Kurzarbeit finanzieren und Massenentlassungen verhindern können (bis zu 100 Milliarden). Es mag an meiner geringen juristischen Expertise liegen, aber allein diese verkürzelten Sprachgebilde dienen nicht der europäischen Euphorie. In dieser dramatischen Krise kommt es nicht nur darauf an, ob es am Ende ökonomische Hilfen gibt, sondern auch ob sie so widerwillig, so herablassend nur zugestanden werden, dass sie nicht als Ausdruck von Solidarität, sondern als Geste der Demütigung ankommen. Das wird nicht nur nicht reichen. Es wird auch nicht vergessen werden.
Ansonsten: Feiertag. Eigentlich ein Tag zum Innehalten. Aber wenn das Innehalten, das Stillhalten, die Isolation schon das verordnete Programm der letzten Wochen war, dann ist mir nicht recht danach. Ein christlicher Freund schrieb mir heute früh: „Wie seltsam wäre es, jetzt Weihnachten zu haben.“ Da hat er natürlich auch wieder recht. „Passion geht irgendwie immer“, fügte er noch hinzu, und da musste ich dann wirklich lachen. In diesem Sinne hoffe ich, dass es einige gute Tage für uns alle werden, ob uns Ostern etwas bedeutet oder Pessach oder nicht. Wenn ich wieder etwas empfehlen darf, fürs lange Wochenende, dann mal etwas Kurzes. Die Erzählungen von J.D. Salinger, die mir immer schon mehr gefielen als der gefeierte „Fänger im Roggen“. Die „Neun Erzählungen“ sind eine besser als die andere, bitter, unversöhnlich, bezaubernd, witzig, sie lassen einen verwirrt, verstört, beglückt zurück, und, wer die anderen Bücher von Salinger liebt, entdeckt auch hier wieder die Geschwister der „Glass“-Familie, die für mich zu den wunderbarsten literarischen Figuren gehören, die es gibt. Mein Favorit ist die erste Erzählung in dem Band, „Ein guter Tag für Bananenfisch“, aber sie ist zu düster für diese Krise, die sollte man sich für hellere Tage aufheben. Aber die Geschichte „Unten beim Boot“, die von Lionel erzählt, der immer von zuhause wegläuft und sich in einem Dingi versteckt und wie er dann gefunden wird - das kommt gerade recht für dieses Wochenende. Passen Sie aufeinander auf und bleiben Sie zuhaus.