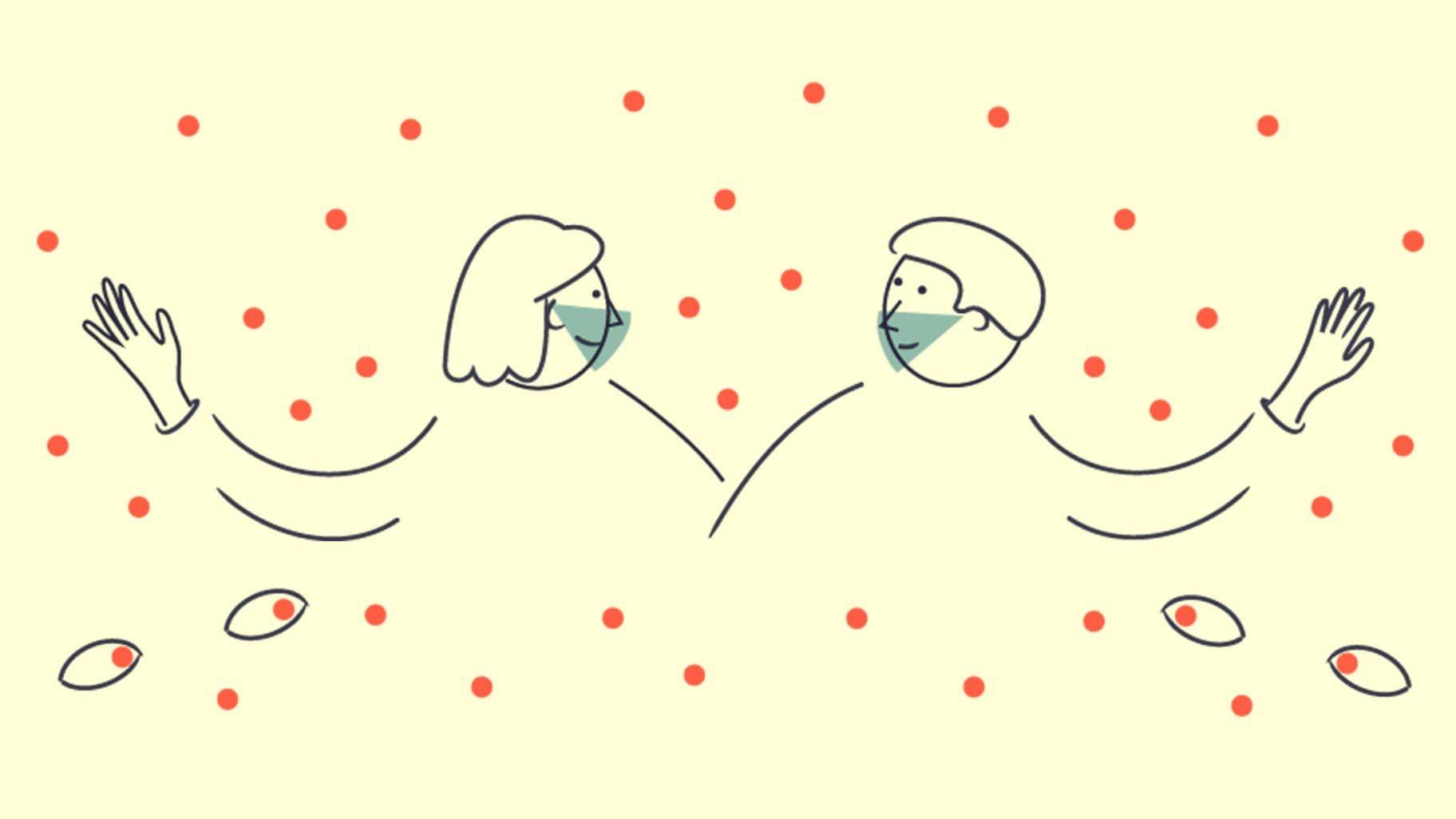„Zeitgeschichte direkt vor der Haustür“
Der Fotograf Patrick Junker hat das Corona-Jahr in Bilder gefasst – und zeigt, was Menschen leisten, die dem Virus ganz nahe kommen.
Mitte März 2020, das Coronavirus hat längst Deutschland erreicht, die Zahlen steigen, Merkel warnt: „Es ist ernst.“ Patrick Junker, 29, der zu dieser Zeit in Hannover Fotojournalismus studiert, ist klar: „Das hat historische Ausmaße, die wir alle noch nicht abschätzen können.“ So erzählt er es später am Telefon, am Ende dieses seltsamen Corona-Jahres. Sein erster Reflex war der vieler Menschen: zu Hause bleiben. Doch dann entschied er sich für das Gegenteil. „Ich bin Fotojournalist, jetzt habe ich die Zeitgeschichte direkt vor meiner Haustür, ich muss das fotografieren“, sagt er.
Doch wie fasst man eine Pandemie in Bilder? Indem man Wattestäbchen und Einwegmasken abbildet? Leere Straßen und Schilder an Restauranttüren dokumentiert? Patrick Junker wusste schnell, sein Projekt, das später zu seiner Bachelorarbeit und einer Ausstellung im öffentlichen Raum in Stuttgarter anwuchs, sollte darüber hinausgehen. Er gab ihm den Titel: „There is glory in prevention“.

Man kennt den Satz in verneinter Form: „There is no glory in prevention“ – durch Vorsorge erlangt man keinen Ruhm. Der Virologe Christian Drosten hat ihn schon früh in der Pandemie formuliert. Denn wer gut vorsorgt, der verhindert im besten Fall zwar die Katastrophe, doch dann heißt es: Die Maßnahmen waren ja gar nicht nötig. Patrick Junker wollte zeigen, dass es mehr als rühmlich ist, was all die Ärztinnen und Therapeuten leisten.
Also ging er ins Marienhospital in Stuttgart auf die Covid-19-Station, zwölf Tage Schichtdienst, begleitete Ärzte, Pfleger und Physiotherapeutinnen, fuhr mit einem Testmobil durch die Stadt, besuchte Angehörige und ein Desinfektionsunternehmen. Er ging dorthin, wo das Virus war und wo man mit aller Kraft versuchte, es fernzuhalten. „Ich will, dass die Gesellschaft versteht, wie es ist, in Pflegeberufen zu arbeiten“, sagt er.
Patrick Junker hatte als freier Fotograf bereits eine Herztransplantation fotografiert und eine Hausgeburt, heikle und intime Momente, in denen man eigentlich keine Zuschauer gebrauchen kann. Doch ihm gelingt es, diese Szenen sensibel und würdevoll einzufangen. Dass er schon im medizinischen Bereich fotografiert hatte, kam ihm nun zugute – und war auch ein Grund, warum das Stuttgarter Krankenhaus zusagte, nachdem sieben andere abgesagt hatten.
Herausgekommen ist nach mehreren Monaten eine Chronologie der Pandemie, ein Kaleidoskop der Krise, das diejenigen zeigt, die handeln. Die Porträts hängen im Großformat an Betonpfeilern in der Stuttgarter Innenstadt. Wie Heldenbilder, was sie im Grunde ja auch sind.

Doch das größte Lob sei für ihn gewesen, sagt Patrick Junker, dass Pflegende ihm geschrieben hätten: Sie fühlten sich und ihren Beruf genau getroffen.
Hier erzählt er die Geschichten hinter den Bildern:
„Marcell Engel leitet einen Betrieb für Desinfektion, Schädlingsbekämpfung und Dekontamination in Bad Soden am Taunus, reinigt Tatorte, Bahnhöfe, Rettungswagen – und brennt für seinen Job. Auf dem Foto desinfizieren Engel und seine Kollegen ein Taxi. Der Taxifahrer, dem es gehörte, hatte zu dem Zeitpunkt kaum Kunden, obwohl er sich so eine Glastrennscheibe eingebaut hat. Er dachte, vielleicht hilft ein Desinfektionszertifikat. Am Anfang der Pandemie wollten ja alle alles desinfizieren. Bei Engel stand das Telefon nicht still, Pflegeeinrichtungen, Restaurantbetreiber. Inzwischen weiß man ja, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird und nicht über Flächen.

Die Spezialschutzausrüstung wäre für das Coronavirus zwar nicht nötig gewesen, aber Engel und seine Kollegen sind Schlimmeres gewöhnt, wenn sie als Tatortreiniger und Spezialreiniger irgendwo anrücken. Die machen auch sauber, wenn sich jemand vor den Zug wirft. Engel hat die WHO in Afrika beraten, als Ebola ausgebrochen ist.
Viele Ladenbesitzer haben gehofft, wenn sie ihre Lokale desinfizieren lassen und das dann auch angeben, kommen die Kunden zurück. Aber das war halt nicht so. Mehrmals hatte Engel Ladenbesitzer beraten und musste dann als Tatortreiniger zu ihnen, weil sie Suizid begangen hatten. Das ist wirklich hart, aber vor diesen Geschichten dürfen wir auch nicht die Augen verschließen.“
„Nadja Beer war gerade mit ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin fertig und hat sich direkt freiwillig für die Covid-19-Station gemeldet. Sie hatte einen unglaublichen Antrieb, war sehr optimistisch und hat den Leuten eine Energie gegeben, die mich sehr beeindruckt hat.
Viele Patienten hatten Angst vor der neuen Krankheit und waren frustriert, sie durften das Zimmer nicht verlassen, hatten nichts zu tun. Da war die Physiotherapie das Highlight des Tages. Nadja Beer kam ihnen viel näher als die Ärzte und Pflegekräfte, sie hat die Patienten massiert, hat sich bei ihnen untergehakt – natürlich mit Visier und FFP2-Maske, aber für manche war das der einzige körperliche Kontakt. Das schien ihnen Mut zu machen.

Eine 98-Jährige hat Nadja Beer einfach an den Händen gefasst, gesagt: ‚Komm, wir tanzen jetzt‘, und mit ihr im Takt gewippt. Die wusste erst gar nicht, was passiert, war dann aber sehr amüsiert. Der Patientin auf dem Foto – das war eine richtige alte Dame, die selbst im Krankenbett geschminkt war – hat sie einen High-Five gegeben. Und einer Patientin sind sogar die Tränen gekommen, weil sie so lange nicht auf so schöne Art und Weise angefasst worden war. Inzwischen schreibt Nadja Beer ihre Bachelorarbeit und hat ein physiotherapeutisches Online-Trainingsprogramm für ehemalige Covid-Patienten entwickelt.“
„Als ich dieses Porträt von der Ärztin Verena Werling ausgewählt habe, habe ich ihr gesagt: Überleg’s dir gut. Wenn es erst mal 1,80 auf 1,50 Meter in Stuttgart hängt, dann hängt es da. Aber sie fand, dass man auch dieses Gesicht zeigen muss, mit all der Erschöpfung. Ich habe es kurz nach einem Massentest im Seniorenzentrum aufgenommen.

Zusammen mit ihrem Kollegen vom Roten Kreuz ist Verena Werling mit einem Testmobil in Pflegeheime und zu den Leuten nach Hause gefahren, um sie zu testen. Das hat mich schon beeindruckt, wie diese Menschen sagen: Keine Lust auf Corona zu haben, hilft uns nicht. Wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Verena Werling ist jeden Tag zwischen Karlsruhe und Stuttgart gependelt, weil dort ihre Mutter lebt und auf ihren Sohn aufgepasst hat. Die Mutter gehörte zur Risikogruppe, Verena Werling durfte sich also auf keinen Fall anstecken, das kam als Belastung noch dazu. Ich war dreimal mit ihr im Testmobil unterwegs und habe sie im Sommer auch zu Hause besucht, als die Infektionszahlen niedrig waren. Trotzdem haben wir sehr auf Abstand geachtet. Wenn ich da reinkomme und womöglich noch die Mutter anstecke – oh Gott.“
„Michael Heinold ist Oberarzt auf der Covid-19-Intensivstation. Eine Situation ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: Heinold hat einem Patienten eine Fotocollage mit Bildern von dessen Frau und Tochter gezeigt und gefragt: ‚Wer ist das? Was ist in dem Korb drin? Sind das Äpfel oder Nüsse?‘ So hat er versucht herauszufinden, ob er neurologische Schäden hat. Der Patient, Wenzel D., war gerade aus dem künstlichen Koma erwacht. Er hat durch einen Luftröhrenschnitt geatmet und konnte nicht sprechen, höchstens etwas zeigen oder mit dem Kopf wackeln. Er konnte sich später auch nicht mehr an die Situation erinnern. Aber er hat reagiert auf die Collage. Michael Heinold war sichtlich gerührt.

Wenzel D. lag nämlich 31 Tage im künstlichen Koma. Er war ein Patient, der wirklich auf der Kippe stand. Nach zwei Wochen Koma hatte sich nichts gebessert. Der Oberarzt hat gesagt: Wären weitere Intensivpatienten gekommen, dann hätte man bei ihm wahrscheinlich sagen müssen, dass die Beatmung abgebrochen werden muss. Man muss dann einfach eine gewisse Zeit einführen. Ich glaube, in Italien waren es zwei Wochen.
Es kamen zum Glück keine anderen Patienten. Doch nach dem Koma geht das Leben ja nicht einfach weiter. Dass er seinen Arm hob, war das höchste der Gefühle. Als er erkrankt ist, war er ein normal gesunder 67-Jähriger, ohne Vorerkrankungen. Anfang März hatte er sich angesteckt, man weiß nicht wo, er war nicht Ski fahren, nicht auf Großveranstaltungen. Als ich ihn Ende Oktober noch mal besucht habe, musste er immer noch sein tragbares Beatmungsgerät dabeihaben und ständig die Sauerstoffsättigung in seinem Blut überprüfen.“
„Das war eine Urnenbestattung im April in Dachsenhausen, Rheinland-Pfalz. Nur der Beisetzer Udo Feller und ich waren auf dem Friedhof. Keine Angehörigen, kein Trauerredner, so wollte es damals die Deutsche Friedhofsgesellschaft, die den Friedhof betreibt, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Der Beisetzer hat nichts gesagt, nur kurz innegehalten und dann die Urne in die Erde gesetzt, ein paar Sekunden dauerte das nur, das war schon skurril. Die Angehörigen wussten, dass die Beerdigung zu diesem Zeitpunkt stattfindet, damit sie zu Hause eine Kerze anzünden können. Das ist ein reiner Urnenfriedhof mit anonymen Gräbern, das heißt, später sieht man nur noch eine leere Wiese. Da bleibt kein Kreuz, kein Namensschild.“
Das Projekt findet im Rahmen des Sonderförderprogramms „Kunst trotz Abstand“ des Kunstministeriums Baden-Württemberg und in Kooperation mit der BLOMST! gUG und Zeitenspiegel Reportagen statt.