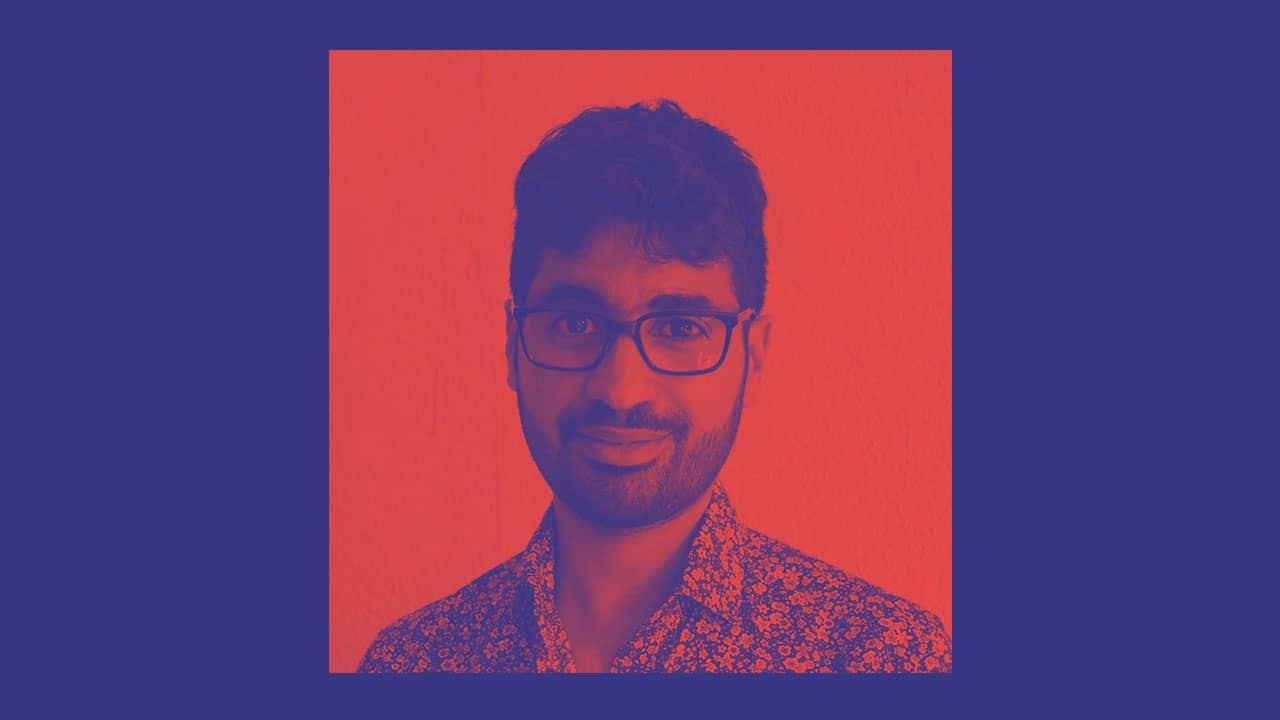SERIE: "WAS SICH ÄNDERN MUSS"
Betroffenheit ist kein Defizit
Die Autorin und Journalistin Alice Hasters fordert, dass sich Redaktionen bei der Auswahl von Nachwuchs mehr anstrengen und erklärt, dass es kein Makel ist, von etwas „betroffen“ zu sein.
In der Serie „Was sich ändern muss“ erklären Medienschaffende aus ganz Deutschland, wie Journalismus vielfältiger werden kann. Die Autorin und freie Journalistin Alice Hasters („Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen“), geboren 1989, fordert, dass sich Redaktionen bei der Auswahl von Nachwuchs mehr anstrengen und erklärt, dass es kein Makel ist, von etwas „betroffen“ zu sein.
Als ich noch bei der Tagesschau gearbeitet habe, hat eine Diversity-Beauftragte einen Schülerbesuch organisiert, damit sich die Jugendlichen ansehen können, wie eine Redaktion arbeitet. Zu mir ins Büro kam ein 16-Jähriger aus einem der Stadtteile, die so gerne als „soziale Brennpunkte“ beschrieben werden. Er hatte sich extra ein Hemd angezogen und war sehr, sehr unsicher. Das versuchte er zu überspielen. Ich habe ihn gefragt, ob er Nachrichten schaut, und er gab etwas patzig zurück: „Natürlich gucke ich Nachrichten.“ Er dachte, ich hätte ein bestimmtes Bild von ihm, und das wolle ich mit meinen Fragen bestätigen. Ich konnte das so gut nachvollziehen, diesen Gedanken, „Ich bin nicht dumm – auch, wenn du das vielleicht denkst“. Ich kenne die Angst, dass Menschen in mir nur ein rassistisches Stereotyp sehen.
Redaktionen müssen sich fragen: Wem wird der Beruf des Journalisten zugetraut? Wer wird als Volontärin oder als Volontär von Medienhäusern aufgenommen? Natürlich kann sich jeder und jede bewerben – theoretisch. Aber viele schrecken davor zurück oder wissen gar nicht, welchen Weg sie einschlagen sollen, um dort anzukommen. Sie müssen sehr viele Hürden überschreiten, manchmal sichtbar, manchmal unsichtbar. Es reicht nicht, dass Redaktionen sich mit Bewerbungen schmücken, in denen steht „Wir begrüßen auch Bewerber mit Migrationshintergrund“ oder ähnliches. Viel hat auch mit Sichtbarkeit zu tun – was bringt die Stellenanzeige oder Ausschreibung, wenn niemand von den Menschen, die sich angeblich angesprochen fühlen sollen, sie sieht?
Strukturelle Diskriminierung ist nun einmal etwas, das sich als sehr resistent herausgestellt hat. Man merkt: Ohne Quote kriegt man es anscheinend nicht hin. Wer wird repräsentiert? Wer sieht sich in gewissen Räumen?
Praktika sind eine Geldfrage
Deswegen müssen Redaktionen dort ansetzen, wo sie etwas ändern können. Sie können zum Beispiel eine Person beauftragen, die sich darum kümmert, diesen Nachwuchs zu akquirieren und zu überlegen, wie man ihn halten kann. Und natürlich braucht man gut bezahlte Praktika. Redaktionen bauen nicht selten darauf, dass Praktikantinnen und Praktikanten als billige oder unbezahlte Vollzeit-Arbeitskräfte eingesetzt werden. Praktika sind die Tür zum Beruf, aber so, wie es gerade ist, sind sie im Journalismus eine Frage des Geldes: Man muss sie sich leisten können.
Oft führe ich mit Kolleginnen und Freunden die Diskussion, ob man jetzt diesen oder jenen Job bekommen hat, weil man schwarz ist. Das mag vielleicht einer der Gründe sein, weil damit eine Perspektive einhergeht, die dringlichst in den Redaktionen gebraucht wird. Der Hauptgrund ist aber der, dass ich meine Arbeit gut mache. Und wenn Leute sowas sagen, wünschte ich mir, dass ihnen bewusst wäre: Viel mehr bekommen andere ihren Job, weil sie weiß sind. Das ist nach wie vor die Regel. Das belegen auch Studien.
Außerdem finde ich es wichtig, von der „Betroffenheit“ als negativem Attribut weg zu kommen. Natürlich sind People of Color im Journalismus vom Thema Rassismus betroffen und werden anders über dieses Thema berichten als Weiße es tun würden. Aber diese Betroffenheit ist kein Defizit. Sie kann ein Gewinn sein, der sich in der Arbeit niederschlägt. Beispiel: Es gibt genügend schwarze Expertinnen zum Thema Rassismus, die eine Expertise haben, weil sie zum Thema geforscht und jahrelang gearbeitet haben – und nicht nur, weil sie selbst Rassismus erleben. Aber natürlich schreiben sie anders darüber, als weiße Expertinnen und bringen ein Wissen mit, das dringend abgebildet werden muss. Sonst fehlt im Rassismusdiskurs etwas.
Dem Jungen, der mich bei der Tagesschau besucht hat, konnte ich damals vermitteln, dass ihn nicht vorverurteile. Und dass er okay ist, so wie er ist. Bevor ich mit ihm gesprochen hatte, hatte er wohl zu der Diversity-Beauftragten gesagt, Journalismus sei nichts für ihn. Nach dem Redaktionsbesuch hat er seine Meinung geändert. Warum? Er konnte sich mit mir identifizieren.