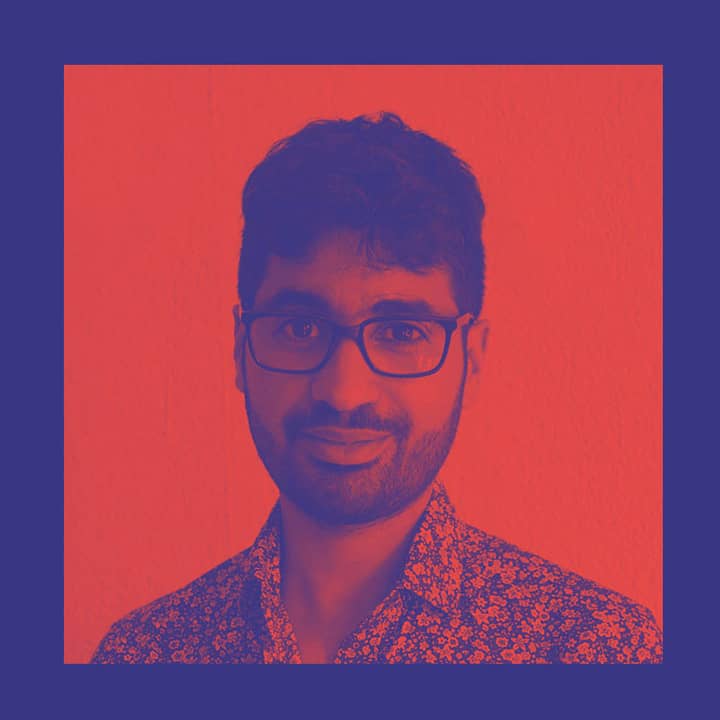
SERIE: "WAS SICH ÄNDERN MUSS"
Nicht nur Objekt der Berichterstattung
Wie kann Journalismus diverser werden – und warum muss das sein? Der Autor und Journalist Mohamed Amjahid erklärt, was mangelnde Vielfalt für Leserin und Leser bedeutet.
In der Serie „Was sich ändern muss“ sprechen Medienschaffende aus ganz Deutschland darüber, was Redaktionen gegen rassistische Strukturen tun können und wie Journalismus diverser werden kann. In der zweiten Folge spricht der Autor und Journalist Mohamed Amjahid, geboren 1988 in Frankfurt, darüber, was ein Medium verliert, wenn es auf Vielfalt verzichtet. Amjahids Buch „Unter Weißen“ erschien 2017.
Rassismus hat strukturellen Charakter, deswegen ist es ein Problem, das zuallererst die Führungskräfte angehen müssen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Das größte Problem, das spannenden Journalismus verhindert, sind Führungskräfte, die der Aufgabe nicht gewachsen sind, ein vielfältiges Team anzuleiten. Das heißt nicht, dass jede Person of Color automatisch eine gute Führungskraft wäre. Es heißt aber, dass rein homogene, weiße, cis-männliche, vielleicht auch heteronormative Führungsebenen ein schlechteres Produkt machen.
Diese Führungsriegen sind Teil der Medienkrise, die wir seit Jahren erleben. Dadurch, dass sie bestimmte Gruppen ausschließen, entgehen ihnen wichtige Inhalte – und das Ergebnis wird langweiliger.
Wir wissen alle, dass es um die Repräsentation von PoC in Redaktionen sowieso nicht gut steht. Aber in Führungsriegen ist das noch viel krasser sichtbar. Wenn immer die Gleichen (also weiße Männer in einem bestimmten Alter) das Sagen haben, können die sich – meistens, nicht immer – in bestimmte Lebensrealitäten nicht oder zumindest schlechter hineindenken. Ein Ressortleiter aus bürgerlichem Hause kann sich schlecht in die Lebenswelt eines Arbeiterkindes versetzen. Männer sowieso schlecht in Themen, die vor allem Frauen betreffen. Und dann gibt es viele Journalisten, die Jura studiert haben und sehr staatszentriert denken: Mit denen über grundsätzliche Systemkritik und rassistische Polizeiwillkür zu streiten, führt oft nirgendwohin. Wenn diese meist wenig von Rassismus betroffenen Männer noch in Entscheidungspositionen sind, ist das doppelt schlimm. Es wird also schwierig, wenn die Gesellschaft, die Journalisten beschreiben, auf der Führungsebene nicht einmal ansatzweise widergespiegelt ist.
Wenn alle in Führungspositionen gleich sozialisiert sind, wird das Ergebnis austauschbar
Das schlägt sich im Produkt nieder. Wir leben in einer postmigrantischen, diversifizierten Gesellschaft. Wenn aber alle Führungspositionen von Menschen besetzt sind und werden, die gleich sozialisiert sind, sehen auch die Medien austauschbar aus – und verlieren damit potenzielle Leser.
Und an die soll man doch zuallererst denken, das hört man als Journalist zumindest immer wieder: „Denk an den Leser.“ Der Satz wird, wenn er ausgesprochen wird, meistens nicht gegendert. Es gibt aber auch Leser*innen und die muss man sich auch vorstellen. Und genauso gibt es Leser*innen, die PoC sind, queer, trans. Man braucht für diese Menschen andere Perspektiven, damit auch sie bereit sind, für eine Zeitung Geld auszugeben, und sie gerne lesen. Ein wesentlicher Fehler hierbei ist, dass zwar viel über Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund oder PoC geschrieben wird, man dabei aber vergisst: Sie sind nicht nur Objekt der Berichterstattung. Sie sind auch potenzielle Zielgruppe. Diese Perspektive erlebe ich in deutschen Redaktionen so gut wie nie.
Ein Anfang sind zum Beispiel Workshops, wie sie einige Redaktionen nun zum Thema Führung und Coaching anbieten. Aber das ist immer noch viel zu wenig und kommt viel zu spät. Die amtierenden weiß-cis-männlich-dominierten Entscheidungsebenen sollten sich an die Realität anpassen und erkennen, dass es mit der homogenen Zusammensetzung in den Chefetagen eigentlich nicht mehr weitergehen kann.












