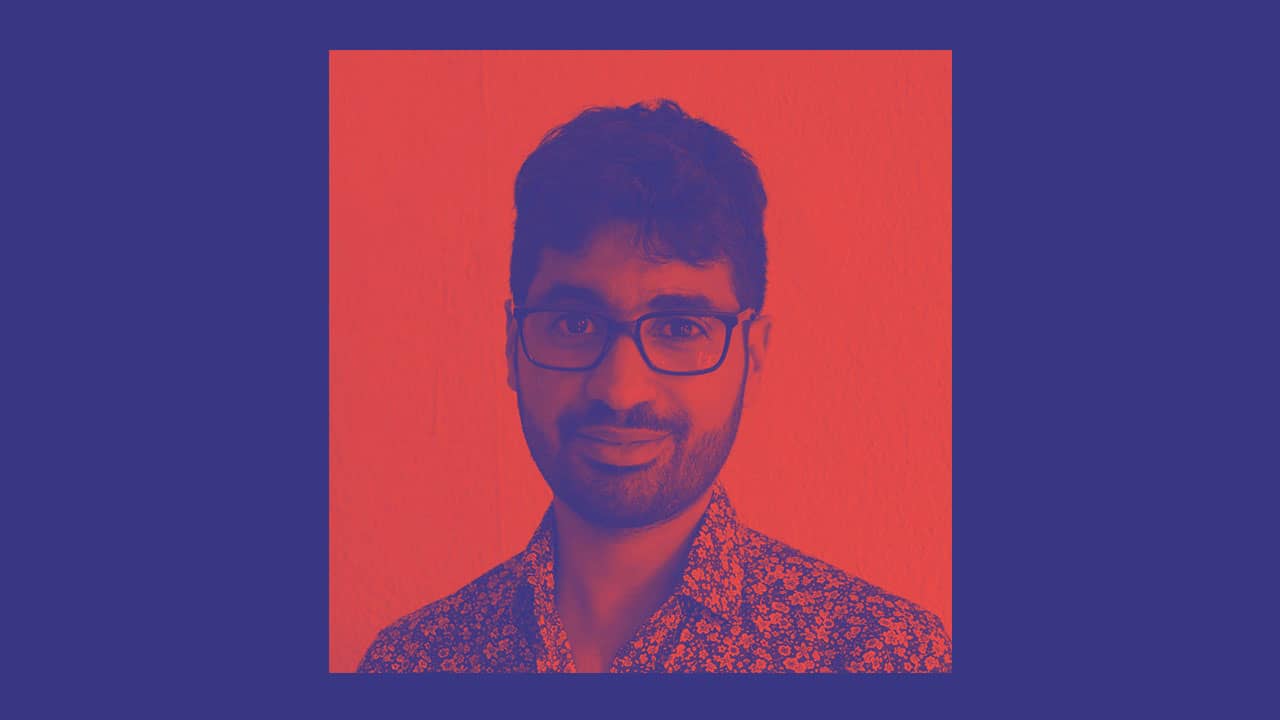SERIE: "WAS SICH ÄNDERN MUSS"
Man sieht diesen Hass
Wozu vielfältiger Journalismus? Saskia Hödl über den psychischen Druck, dem Journalistinnen und Journalisten ausgesetzt sind, wenn sie immer wieder über mordende Rassisten berichten müssen.
In der Serie „Was sich ändern muss“ sprechen Medienschaffende aus ganz Deutschland darüber, was Redaktionen gegen rassistische Strukturen tun können und wie Journalismus diverser werden kann. Die taz-Journalistin Saskia Hödl, geboren 1985, fordert, dass Medienhäuser besser darauf achten sollten, welchem psychischen Druck ihre Mitarbeiter ausgesetzt sind. Hödl ist Ressortleiterin des Ressorts taz zwei für Gesellschaft und Medien.
Schwarze Menschen und People of Color (BPoC) erleben in einem weißen Unternehmen viele Situationen, die ihnen auf Dauer psychisch schaden können. Die journalistische Arbeit kann das verstärken. Drei dieser Punkte möchte ich hier erklären.
Das erste Phänomen nennt sich „Tokenism“ (von engl. token, Spielfigur, Anm. d. Red.). Das bedeutet, dass ein Unternehmen eine Handvoll Personen als „Beweis“ anstellt, um zu zeigen, man bemühe sich ja. Diversität wird simuliert, aber es wird nicht weiter daran gearbeitet, die Gesellschaft in der Belegschaft abzubilden. Man kann das gut mit den Bemühungen um Parität vergleichen: Wenn es in einem Medienhaus voller Männer nur ein paar Frauen gibt, werden diese schnell verpflichtet, die Beiträge zu allem, was Frauen betrifft, selbst zu schreiben – auch wenn sie vielleicht eigentlich Wirtschafts- oder Sportredakteurinnen sind.
Es sind tägliche Grenzüberschreitungen
Das problematische daran ist, dass man keine Wahl hat. So ist es auch für BPoC im Journalismus: Bei Großlagen wie Hanau, Halle, NSU 2.0., George Floyd, wird immer nach nicht-weißen Perspektiven gesucht. Prinzipiell ist das richtig. Aber so lange die Diversität in der Redaktion nicht hoch genug ist, dass auch mal zehn oder zwölf Leuten sagen können: „Ich habe gerade die emotionale Kraft nicht, mich mit mordenden Rassisten auseinanderzusetzen“, und sich dann trotzdem noch eine nicht-weiße Perspektive findet, ist das Unternehmen nicht divers.
Der zweite Punkt sind Mikroaggressionen. Das sind beiläufige, abwertende Äußerungen,die sich entweder absichtlich gegen die Person richten oder die aus Mangel an Sensibilität zustande kommen. Also Dinge wie: „Wo kommst du her, du siehst aber exotisch aus“. Oder auch, wenn einem in journalistischem Kontext Interesse oder Sachlichkeit bei gewissen Themen abgesprochen werden. Es sind tägliche Grenzüberschreitungen. In der Medienbranche kann das noch verstärkt werden durch offen oder unterschwellig rassistische redaktionelle Beiträge von Kolleginnen und Kollegen. Auch das ist eine Form von Mikroaggression im Arbeitsumfeld und etwas, das an BPoC nicht spurlos vorbeigeht. Immerhin will man sich mit seinem Arbeitgeber identifizieren.
Und das dritte Phänomen ist etwas, das sich „white fragility“ nennt. Das meint eine starke Abwehrhaltung, die zu Tage tritt, wenn man Menschen auf sogenannte Alltagsrassismen anspricht. Sie haben dann das Bedürfnis, den Vorwurf abzuwehren, vielleicht aus einem Schuldbewusstsein heraus. Aber auch, weil sie sich sonst damit befassen müssten, sich zu fragen, ob sie nicht vielleicht selbst von Rassismus profitieren.
Menschen, die Rassismus erlebt haben, durchleben ihn erneut
All diese Erlebnisse können dazu führen, dass Betroffene nicht mehr über das, was sie erleben, sprechen. Oder sich in Konferenzen zurückziehen. Weil sie wissen, dass das jedes Mal ein Streit ist, ein Kampf.Das ist eine enorme psychische Belastung. Anschläge wie in Hanau oder Halle oder der Mord an George Floyd im Frühjahr gehen nicht spurlos an den Menschen vorüber. Man sieht diese Videos, man sieht Gewalt, man sieht Angriffe. Man sieht diesen Hass.
Als Betroffene über Rassismus zu schreiben kann retraumatisieren, Menschen, die Rassismus erlebt haben, durchleben ihn erneut, es kommen Leserreaktionen, oft wird man beschimpft. Redaktionen können aber Ansprechpartnerinnen engagieren, die sich um psychische Beratung kümmern. In vielen Redaktionen bilden sich inoffizielle Selbsthilfegruppen. Aber es ist eigentlich nicht die Aufgabe der Arbeitnehmer sich Hilfe zu suchen, weil das Arbeitsumfeld belastend ist, sondern Aufgabe der Arbeitgeber. Was weiße Menschen vor allem tun können, um die Situation für BPoC in Redaktionen zu verbessern ist: zu verstehen, dass Rassismus kein Problem von BPoC ist, für das sie Empathie entwickeln müssen. Sondern, dass es ein Problem von ihnen selbst ist.