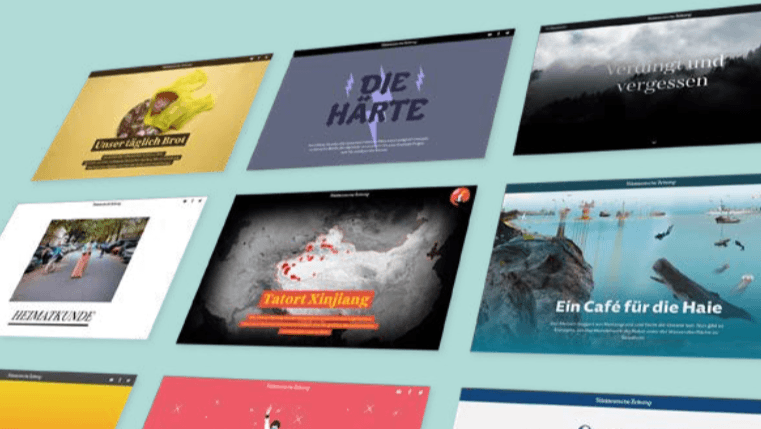Academy Awards
Oscars im Ausnahmezustand
Was passiert im Gehirn, wenn man einen Oscar gewinnt? Die psychiatrische Grundlagenforschung ist in dieser Hinsicht absolut mangelhaft, wenn man bedenkt, dass der Preis in der Nacht zum Montag bereits zum 93. Mal verliehen wird – aber es gibt natürlich Fallbeispiele.
Das Beste ist vielleicht jenes, das Katja Eichinger in der herrlichen Biografie über ihren verstorbenen Mann aufgeschrieben hat. Als Bernd Eichinger Mitte der Achtzigerjahre „Der Name der Rose“ produzierte, engagierte er unter anderem den Schauspieler F. Murray Abraham.
Ob er die kleine Goldstatue eincheckte oder gleich auf dem Schoß als Handgepäck transportierte, ist nicht überliefert. Aber wir können festhalten: Der Gewinn eines Oscars kann zu einer besonderen Form des Größenwahns führen – der Hollywoodhybris. Was natürlich daran liegt, dass der Oscar der wichtigste Filmpreis der Welt ist, vielleicht sogar der bekannteste Preis überhaupt, begleitet von einem einzigartigen Presserummel. Zumindest normalerweise. Denn dieses Jahr herrscht ausgerechnet in Hollywood, dem Ort der roten Teppiche, der großen Träume und des Zwangsoptimismus eine große Katerstimmung, was die Oscars angeht.
Das vergangene Hollywoodjahr, dessen Zeitrechnung nicht von Dezember bis Dezember geht, sondern von Oscarverleihung zu Oscarverleihung, war eine Katastrophe. Vorsichtig gesagt. Die Kinos fast durchgehend dicht, die Festivals fast alle abgesagt, das Boxoffice weltweit auf einem Allzeittief. Keiner der beiden Weltkriege hat es vermocht, Hollywood so in die Knie zu zwingen wie das Coronavirus.
Die Preisverleihungen, die jedes Jahr zu den Oscars hinführen, von den Golden Globes über die vielen kleinen Veranstaltungen der Regie- und Schauspielgewerkschaften, hatten in ihrer ganzen Videokonferenzhaftigkeit diesmal die Sexyness einer Skype-Fernbeziehung. Ähnliches könnte den Oscars drohen, die wegen Corona von ihrem Stammtermin im Februar verschoben werden mussten und jetzt zwar vor Ort, aber in einer abgespeckten Version stattfinden, verteilt auf mehrere Übertragungssorte, um die Hygieneregeln zu wahren.
Zusätzlich unken die amerikanischen Medien schon ohne Corona-Logistik, dass die Einschaltquoten der Oscars doch sowieso dramatisch sinken, allein in den USA. Während im „Titanic“-Jahr 1998 noch knapp 60 Millionen Zuschauer einschalteten, waren es im vergangenen Jahr nur noch 23,6 Millionen. Und die Zeitschrift Variety, tägliche Pflichtlektüre auf den Frühstückstischen der Stars, wertete eine niederschmetternde Studie aus. Durch die Verlegung der Kinobranche ins unübersichtliche Streaming-Meer Internet, kenne kaum ein Zuschauer die Filme, die dieses Jahr nominiert seien. Zum Beispiel hätten nur 18 Prozent der Befragten jemals etwas von der Netflix-Produktion „Mank“ gehört – und „Mank“ ist von den zehn Werken, die als bester Film nominiert sind, noch der mit dem größten Starfaktor. Regie: David Fincher. Hauptrolle: Gary Oldman.
Sind die Oscars 2021 also ein Abschreibungsobjekt? Ein Jahrgang, dem für immer der Makel der Corona-Depressionsausgabe anhaften wird, für die sich niemand interessiert hat?
Es gibt, trotz aller Widrigkeiten, gute Gründe, die dagegensprechen. Zunächst einmal erinnert sich rückblickend kaum jemand an die Umstände, unter denen ein Oscar gewonnen wurde.
Außerdem kann eine Auszeichnung wie diese gerade nach einem Jahr fast ohne rote Teppiche, Festivals und Kinos manchen Filmen nochmal einen kräftigen Schub geben. Auch die Kinos könnten davon profitieren. Und zwar wenn sie wieder flächendeckend öffnen und Hollywood nicht sofort neue Ware liefert, weil die Studios für Neustarts immer einen Vorlauf brauchen. Dann wären ein paar nicht mehr ganz neue, aber immerhin oscarprämierte Filme möglicherweise die Rettung, bis endlich der neue James Bond startet.
Zumal die sinkenden Einschaltquoten der Oscarverleihung sich bislang nicht auf die Werbe- und Strahlkraft eines oscarprämierten Films ausgewirkt haben – im Gegenteil. Oscars sind immer gut fürs Geschäft, egal wie viele Leute sich anschauen, wie sie verliehen werden.
Das erzählen fast alle Kinobesitzer, die man fragt. Thomas Kuchenreuther, der in München das ABC und das Leopold betreibt, sagt sogar: „So viel wie in den letzten Jahren haben die Oscars früher nicht bewirkt“. „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ und „Parasite“ zum Beispiel seien erst nach ihrer Auszeichnung ein richtiger Erfolg an der Kinokasse geworden. Und zwar, weil sie vorher in der Menge der Filme, die durch die Streamingdienste von Jahr zu Jahr immer unüberschaubarer wird, fast untergegangen wären.
Die wichtigste Oscar-Erkenntnis: Der Mensch hat zu wenig Alkohol im Blut
Und von den äußeren Umständen abgesehen, zeigt schon das Feld der Nominierten, dass es sich zwar nicht um den prominentesten aller Filmjahrgänge handelt. Aber 2021 ist nicht nur trotzdem, sondern vielleicht gerade deswegen ein interessanter Filmjahrgang.
Lange wurde die amerikanische Filmakademie scharf dafür kritisiert, dass die Filme, die sie für die Oscars nominiert, nur einen schmalen Ausschnitt der Kinokunst repräsentieren und nie das große Spektrum. Aber diesmal hat sich ganz schön was getan. Es scheint sich gelohnt zu haben, dass die Akademie mit ihren mittlerweile knapp 10 000 stimmberechtigten Mitgliedern viele Neuzugänge unterschiedlichen Geschlechts, Alters und Herkunft aufgenommen hat.
Das Ergebnis sieht man dieses Jahr deutlich in der Königskategorie „Bester Film“ mit ihren zehn Nominierten. Es ist bestimmt nicht jeder dieser zehn Filme ein Meisterwerk. Aber so bunt durchgemischt, was Filmemacher, Inhalt, Stil und Budgets angeht, war diese Kategorie in der knapp hundertjährigen Geschichte der Academy Awards vermutlich noch nie.
Der Film zeichnet ein vollkommen anderes Frauenbild als das Klischee vom hübschen Heldensidekick, das die Oscars bis vor Kurzem noch gern honoriert haben.
Die größten Siegchancen dürfte dieses Jahr aber das Drama „Nomadland“ der Regisseurin Chloé Zhao haben. Ein Roadmovie über eine Witwe, die sich nach dem Tod ihres Mannes in ihren Wohnwagen setzt und durch die amerikanische Peripherie reist. Die Hauptrolle ist mit Frances McDormand prominent besetzt, ansonsten handelt es sich um eine kleine Independent-Produktion. Sie hat nur etwa fünf Millionen Dollar gekostet, Peanuts in Hollywood. Aber diese Geschichte aus dem amerikanischen Hinterland zwischen Truckstops und Amazon-Lagern, Trailerparks und Wüstensand scheint ein Amerikabild einzufangen, das die Gemüter im Krisenjahr mehr bewegt als jedes Kostüm- und Actionspektakel: Bei den Preisverleihungen im Vorfeld der Oscars hieß der Sieger fast immer: „Nomadland“.
Aber auch im Rest der Welt sind trotz Corona tolle Filme erschienen. Ein weiterer, fast sicherer Tipp zum Wetten: In der Kategorie „Bester internationaler Film“ führt kaum ein Weg an der dänischen Tragikomödie „Der Rausch“ von Thomas Vinterberg vorbei. Er erzählt von einer Gruppe frustrierter Gymnasiallehrer in der Midlifecrisis. Die Männer bewundern einen Philosophen, der behauptet, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig im Blut auf die Welt kommt – der Ursprung all seines Leids. Eine Theorie, die sie natürlich sofort mit Bier und Wodka in die Praxis umsetzen müssen, und wie dieses Experiment endet, ist fraglos oscarwürdig.